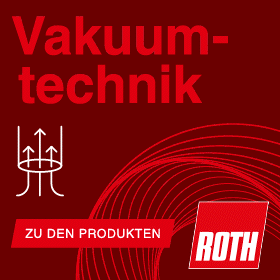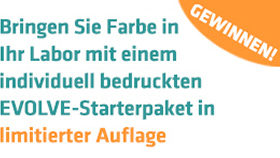Oft heißt es in der Wissenschaft: Wichtiger als Antworten zu finden ist es, die richtigen Fragen zu stellen. Bleiben wir kurz dabei – und fragen unsererseits: Wodurch zeichnen sich „richtige Fragen“ aus? Wohl dadurch, dass sie den Weg zu klaren Experimenten ermöglichen, deren Resultate zu wichtigen neuen Erkenntnissen führen.
Oft heißt es in der Wissenschaft: Wichtiger als Antworten zu finden ist es, die richtigen Fragen zu stellen. Bleiben wir kurz dabei – und fragen unsererseits: Wodurch zeichnen sich „richtige Fragen“ aus? Wohl dadurch, dass sie den Weg zu klaren Experimenten ermöglichen, deren Resultate zu wichtigen neuen Erkenntnissen führen.
Und damit wären wir bei einem Knackpunkt der ganzen Sache angekommen. Denn ob eine Frage „richtig“ in dem Sinne war, dass sie tatsächlich zu „wichtigen“ Erkenntnissen führte, entpuppt sich oft erst lange nachdem man sie ursprünglich gestellt hatte. Woraus zwangsläufig folgt: Wenn man im Voraus beurteilen will, ob eine Frage zu wichtigen Erkenntnissen führen werde, kann man ganz schön daneben liegen.
Nehmen wir als Beispiel eine frisch veröffentlichte Studie zur Blaufärbung von Heidelbeeren (Sci. Adv., doi.org/mf5t). Die Autoren um Rox Middelton von der Universität Bristol formulieren gleich zu Beginn der Einleitung ihres Artikels die entscheidende Frage:
Heidelbeeren sind sichtbar blau – die Pigmente, die sie enthalten, sind es jedoch nicht. So zeigen neuere Arbeiten auch deutlich, dass die Farbvariationen von Heidelbeeren tatsächlich nicht in erster Linie von deren Pigmentierung abhängen. Die Anthocyane, die diese Früchte in hohen Konzentrationen enthalten, haben im Allgemeinen dunkelrote Streuprofile. Wie kommen dann Früchte wie Heidelbeeren und Schlehen zu ihrer blauen Farbe?
Warum kann einem die Heidelbeere blau aus den Büschen entgegenleuchten, wenn sie doch nur dunkelrote Anthocyane als Farbstoffe enthält? Eine Frage, die eigentlich schon sehr lange formuliert sein dürfte – schließlich ist der aus den blauen Beeren gewonnene Heidelbeersaft tatsächlich dunkelrot (siehe Bild oben). Doch offenbar war es für die Wissenschaft bislang nicht wirklich eine richtige Frage – also eher keine, die den Gewinn neuer und vielleicht sogar wichtiger Erkenntnisse versprach.
Entweder Rox Middelton et al. sahen dies nun anders, oder sie gingen sie einfach trotzdem mal an. Middelton dazu in einer Pressemitteilung: Diesen Beitrag weiterlesen »



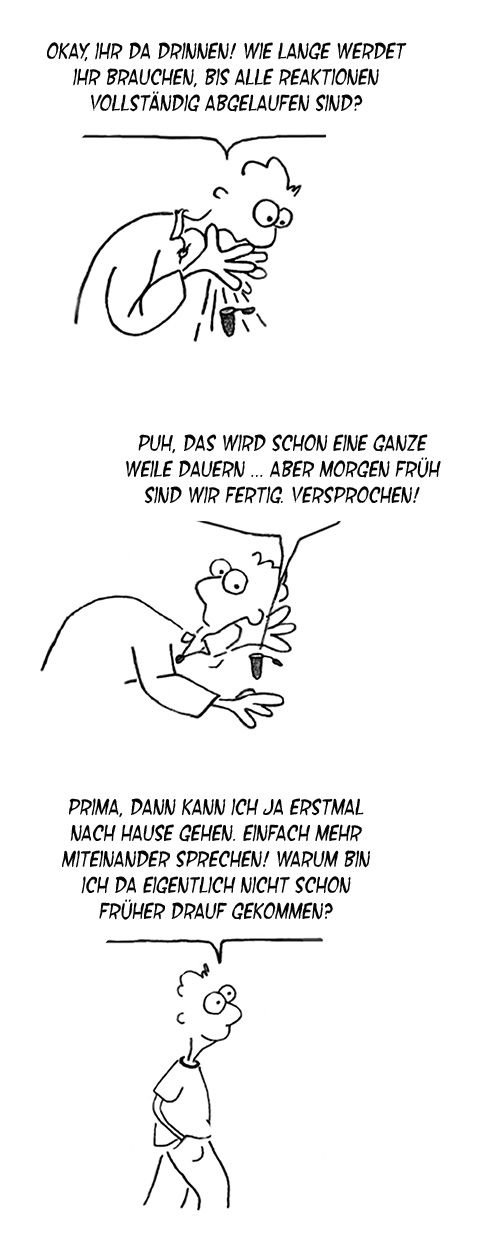

 Tomatensaft ist nicht jedermanns Sache. Zwar stellt allein Deutschland jährlich rund 22 Millionen Liter des Gebräus her. Doch sein muffiges Aroma versagt dem Nachtschatten-Elixier einen Platz in der Haute Cuisine. Mit einem simplen Trick lässt sich das tomatige Geschmackserlebnis indes aufwerten: Begeben Sie sich einfach auf mehrere tausend Meter Höhe. Über den Wolken werden Sie seinen fruchtigen Duft und süß-frischen Geschmack loben. Erdige und giftige Untertöne sind dort verflogen. So schenkt alleine die Lufthansa an Bord ihrer Maschinen jährlich etwa zwei Millionen Liter Tomatenjuice aus. So viel wie Bier!
Tomatensaft ist nicht jedermanns Sache. Zwar stellt allein Deutschland jährlich rund 22 Millionen Liter des Gebräus her. Doch sein muffiges Aroma versagt dem Nachtschatten-Elixier einen Platz in der Haute Cuisine. Mit einem simplen Trick lässt sich das tomatige Geschmackserlebnis indes aufwerten: Begeben Sie sich einfach auf mehrere tausend Meter Höhe. Über den Wolken werden Sie seinen fruchtigen Duft und süß-frischen Geschmack loben. Erdige und giftige Untertöne sind dort verflogen. So schenkt alleine die Lufthansa an Bord ihrer Maschinen jährlich etwa zwei Millionen Liter Tomatenjuice aus. So viel wie Bier! Klar, was unserem Urin die gelbe Farbe gibt – das weiß man bereits seit über hundert Jahren: Urobilin heißt der Farbstoff, und der entsteht seinerseits aus dem orangefarbenen Bilirubin.
Klar, was unserem Urin die gelbe Farbe gibt – das weiß man bereits seit über hundert Jahren: Urobilin heißt der Farbstoff, und der entsteht seinerseits aus dem orangefarbenen Bilirubin.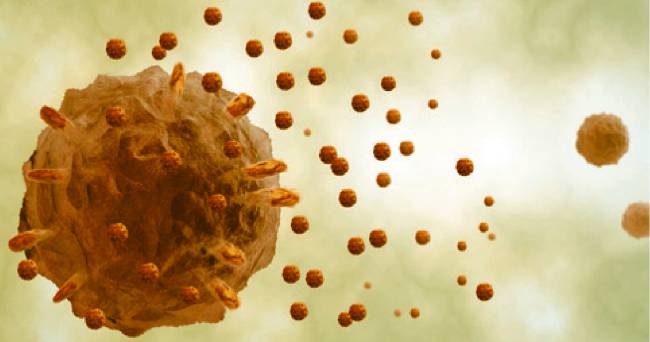


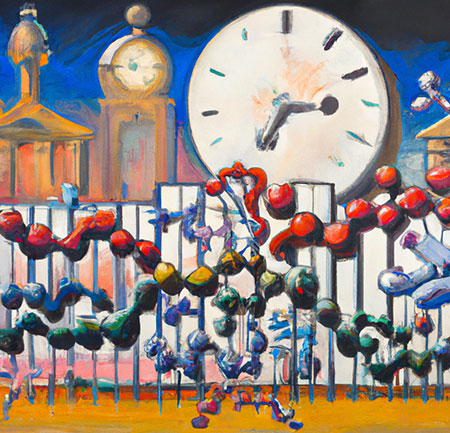 Ein wenig stiefmütterlich scheint die Forschungsgemeinde bislang hingegen den Faktor Zeit ins Kalkül genommen zu haben. Oder genauer gesagt: Wie vorgegebene Zeitspannen für das Einrichten konkreter Regulationsmechanismen genutzt werden.
Ein wenig stiefmütterlich scheint die Forschungsgemeinde bislang hingegen den Faktor Zeit ins Kalkül genommen zu haben. Oder genauer gesagt: Wie vorgegebene Zeitspannen für das Einrichten konkreter Regulationsmechanismen genutzt werden.