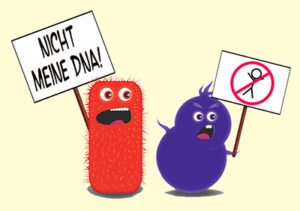Es ist bemerkenswert, dass ein alltägliches biologisches Phänomen derart lange unerklärt blieb.
So bringt es Brantley Hall vom Department of Cell Biology and Molecular Genetics der University of Maryland auf den Punkt. Tatsächlich war bis jetzt nicht wirklich bekannt, was unseren Urin gelb macht. Hall et al. haben die alte Frage nun gelöst – und, wie das bei der Auflösung eines langwierigen Rätsel meist der Fall ist, an prominenter Stelle veröffentlicht: Nature Microbiology 9, 173-84.
 Klar, was unserem Urin die gelbe Farbe gibt – das weiß man bereits seit über hundert Jahren: Urobilin heißt der Farbstoff, und der entsteht seinerseits aus dem orangefarbenen Bilirubin.
Klar, was unserem Urin die gelbe Farbe gibt – das weiß man bereits seit über hundert Jahren: Urobilin heißt der Farbstoff, und der entsteht seinerseits aus dem orangefarbenen Bilirubin.
Etwas weiter ausgeholt: Beim Abbau des Häms roter Blutkörperchen entsteht unter anderem konjugiertes Bilirubin. Dieses wird in den Darm überführt, der es zum Teil ausscheidet. Einen anderen Teil dekonjugieren Beta-Glucuronidasen zu freiem Bilirubin, welches daraufhin ins Serum des Darm-Leber-Kreislaufs rückresorbiert wird. Zugleich können Darmbakterien das Bilirubin weiter zum farblosen Urobilinogen reduzieren, das unmittelbar weiter zum gelben Urobilin oxidiert wird. Dieses kann in der Folge deutlich bequemer über den Urin aus dem Serum entsorgt werden und erleichtert somit das Auswaschen des gesamten anfallenden Bilirubins.
Die große Unbekannte in dem ganzen Abbau-Spiel war bis heute jedoch das Enzym, das Bilirubin zum instabilen Zwischenprodukt Urobilinogen reduziert. Dass es Bilirubin-Reduktase heißen würde, war schon lange klar, doch nun haben Hall et al. es endlich auch molekular aufgespürt: Mit ausgiebigem Metagenom-Screening unserer Darmbakterien identifizierten sie es vor allem in Vertretern des Stammes Firmicutes, oder neuerdings Bacillota. Womit zugleich auch klar wurde, warum sowohl eine geschädigte wie auch die noch nicht voll ausgebildete Darmflora von Säuglingen zu Fällen von Gelbsucht führen können: Das abgebaute Bilirubin kann im Leber-Darm-Kreislauf nicht ausreichend reduziert werden, und der entstehende Überschuss wird in Haut und Augäpfeln eingelagert.
Ein Zusammenhang, der es umso verwunderlicher macht, dass dieser Mechanismus erst jetzt entschlüsselt wurde. Zumal die Metagenomik schon eine ganze Weile gut und mächtig funktioniert. Und zumal die prominente Veröffentlichung ja quasi im Voraus garantiert war.
Ralf Neumann
(Zeichnung: Randomtoons)