 Letzte Woche ist unser neues Heft 3/2022 erschienen – und darin ab Seite 21 der Artikel „Gute wissenschaftliche Praxis – ein alter Hut, oder!?“ von Henrik Müller.
Letzte Woche ist unser neues Heft 3/2022 erschienen – und darin ab Seite 21 der Artikel „Gute wissenschaftliche Praxis – ein alter Hut, oder!?“ von Henrik Müller.
Im Vorspann des Artikels heißt es:
Wissenschaftsskandale entstammen häufig den Lebenswissenschaften. Mangelt es Biologen und Medizinern an Integrität? Oder existieren einfach nur keine guten wissenschaftsethischen Fortbildungsveranstaltungen?
Es geht also um folgendes:
Nachdem inzwischen schon lange Richtlinien, Regeln und Verhaltenskodizes für Integrität in der Forschung formuliert und ausgegeben sind, könnte man doch meinen, dass man der Forscherzunft die entsprechenden Inhalte nur eindringlich beibringen müsste – und schon wären Forschungsfälschung und Reproduzierbarkeitskrise samt zugehörigem Vertrauensverlust weitgehend Geschichte. Und so wurden für den wissenschaftlichen Nachwuchs an vielen Orten verpflichtende Lehrveranstaltungen über Integrität in der Forschung aus dem Boden gestampft.
Soweit also die Theorie! Aber wie sieht die Praxis aus? Wie kann wissenschaftliche Integrität erfolgreich gelehrt werden? Genau das hat sich unser Autor Henrik Müller für seinen Artikel anhand konkreter Beispiele einmal genauer angeschaut …
Doch kaum war das Heft mit dem Artikel in der Druckerei, stieß unser Chefredakteur in Times Higher Education auf einen Artikel mit dem Titel „Around one in 12 postgraduate researchers would publish fraudulent results if it helped them get ahead, says study“. Darin wurde eine internationale Studie zusammengefasst, die gerade in Frontiers of Psychology (doi: 10.3389/fpsyg.2021.621547) erschienen war – und in deren Abstract die Autoren sinngemäß schreiben:
Betrügerische oder unethische Forschungspraktiken haben über die wissenschaftliche Welt hinaus für viel Aufsehen gesorgt. Will man die Wissenschaft indes verbessern, muss man in der Ausbildung von der Doktoranden damit beginnen. Schließlich sind sie die Wissenschaftler von morgen.
In vier Studien mit 765 Doktoranden untersuchten wir daher, ob Doktoranden zwischen ethischen und unethischen oder sogar betrügerischen Forschungspraktiken unterscheiden können. Überdies prüften wir die Bereitschaft der Doktoranden, Forschungsergebnisse aus zweifelhaften Praktiken zu veröffentlichen – und testeten, ob die Entscheidung durch Druck von Vorgesetzten oder Kollegen beeinflusst wird. Parallel befragten wir 36 akademische Führungskräfte (Dekane, Prodekane und AG-Leiter) und baten sie vorherzusagen, wie sich die Doktoranden in den hypothetischen Szenarien verhalten würden.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass einige Doktoranden relativ schnell bereit sind, Ergebnisse zu veröffentlichen, die durch offenkundigen Betrug und Datenfälschung zustandekommen. Alarmierend dabei ist, dass einige Hochschullehrer dieses Verhalten unterschätzen. Offenbar müssen diese stärker im Blick haben, dass Doktoranden unter größerem Druck stehen können, als ihnen bewusst ist – und dass sie daher besonders anfällig für die Anwendung von fragwürdigen Forschungspraktiken sein können.
In konkreten Zahlen kam bei der Umfrage heraus, dass etwa jede zwölfte Doktorandin oder Doktorand bereit wären, unsaubere Daten zu veröffentlichen, wenn dies für die weitere akademische Karriere von Nutzen wäre.
Die Frage ist nun, ob man diesen Anteil durch besseres Research Integrity Training noch weiter nach unten drücken könnte? Dazu bemerkte der belgische Erstautor Rens van de Schoot in dem Times-Higher-Education-Artikel mit Blick auf die eigenen Umfrageergebnisse ziemlich ernüchternd:
Sicher, man hätte erwarten können, dass eine Schulung oder Fortbildung in Forschungsethik einen Unterschied macht – aber das war nicht der Fall.
Auch in unserem Artikel berichtete ein Veranstalter von Research-Integrity-Kursen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hinterher zwar besser über gute und schlechte Forschungspraxis bescheid wüssten. Ob damit auch deren eigene moralische Urteilskraft gereift sei, wagte er allerdings nicht zu beurteilen. Um dies zu ermöglichen, wäre es vor allem wünschenswert, wenn die Dozenten solcher Kurse sich öfter als bisher die Mühe machen würden, den Lehrerfolg ihrer Veranstaltungen zu evaluieren.
Ralf Neumann
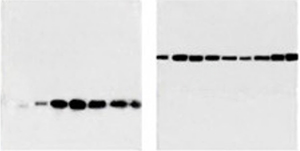

 Letzte Woche ist unser
Letzte Woche ist unser  Können wir bitte eine aufgeschlossene, ehrliche und tabufreie Diskussion über wissenschaftlichen Betrug führen? Wie man ihn verhindern kann, und wie man damit umgehen sollte?
Können wir bitte eine aufgeschlossene, ehrliche und tabufreie Diskussion über wissenschaftlichen Betrug führen? Wie man ihn verhindern kann, und wie man damit umgehen sollte?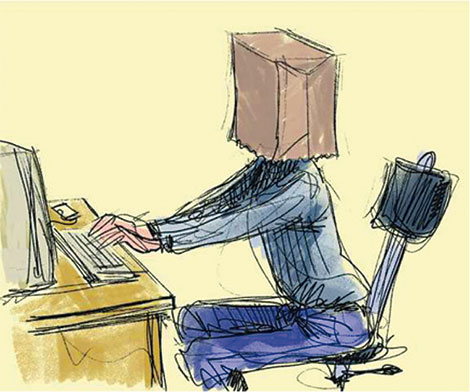
 Früher hieß es: Es ist publiziert, also stimmt es! Oft beendete man noch jegliche kritische Diskussion mit den Argumenten des Peer-Review und des Journal-Impaktfaktors. Den Grund dafür, dass publizierte Versuchsergebnisse im eigenen Labor nicht zu reproduzieren waren, suchte man dann ausschließlich bei sich selbst.
Früher hieß es: Es ist publiziert, also stimmt es! Oft beendete man noch jegliche kritische Diskussion mit den Argumenten des Peer-Review und des Journal-Impaktfaktors. Den Grund dafür, dass publizierte Versuchsergebnisse im eigenen Labor nicht zu reproduzieren waren, suchte man dann ausschließlich bei sich selbst.



