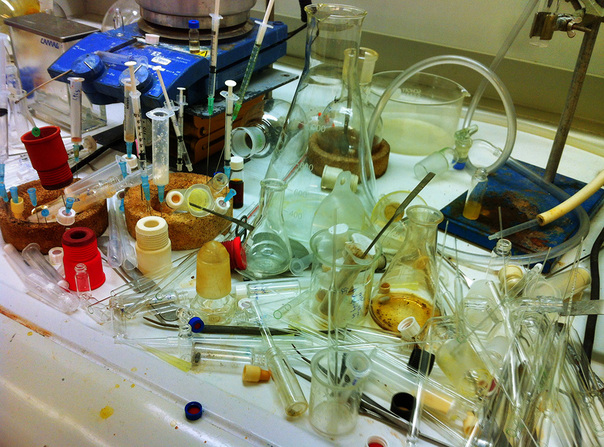Kürzlich klagte jemand in einer E-Mail an die Redaktion: „Da gibt es etwas, das ich einfach nicht verstehe. Schon vor zwanzig Jahren hörte ich Doktoranden und Postdocs immer wieder stöhnen, wie schlimm sich das Wissenschaftssystem entwickelt habe und wie sehr sie unter prekären Arbeitsverhältnissen sowie Instituts-Hierarchien und -Platzhirschen leiden würden. Jetzt sind die meisten von ihnen selbst Gruppenleiter, Instituts-Chef oder sogar noch mehr. Aber nichts hat sich geändert, sie verhalten sich heute genauso wie diejenigen, die sie damals kritisiert haben – vielleicht sogar noch schlimmer. Dabei sind doch sie es, die heute die Dinge tatsächlich ändern könnten, über die sie damals noch so gemeckert haben – wenigstens in ihrem eigenen Umfeld. Da muss man sich schon fragen: Wollen sie das inzwischen vielleicht gar nicht mehr?“
Gute Frage. Eine mögliche Antwort lautet: Sie wollen schon lange etwas anderes. Stehen für Promovierende und junge Postdocs anfangs noch Neugier und Erkenntnisdurst im Vordergrund ihres Forschungsstrebens, rückt mit zunehmender Zeit ihre eigene prekäre Situation angesichts zeitlich befristeter Verträge und Förderungen immer stärker ins Bewusstsein. Mit der Folge, dass die Forschung an sich für Jungforscherinnen und Jungforscher zunehmend seinen Selbstzweck verliert – und stattdessen als „Mittel zum Zweck“ für das eigene Karriere-Management herhalten muss. Aufgrund der prekären Situation wird das Karriere-Management jedoch zwangsläufig zum Risikomanagement – und der Nachwuchs kann es sich daher immer weniger leisten, nur aus reiner Neugier spannenden, aber riskanten Projekten nachzugehen.
Das Dumme ist, dass diese Art Karriere-Management von diesem Punkt an nicht mehr aufhört – auch an der Spitze der Pyramide nicht. Gut, dort heißt das dann wohl eher „Reputations-Management“. Aber die Lage bleibt ähnlich heikel: Für die Allermeisten fließen die Fördermittel nur sehr kurzatmig, und der Publikations-Strom darf nicht abreißen. Das ist natürlich weiterhin Gift für riskante Forschungsvorhaben, sorgt aber noch für etwas anderes: Man bleibt im System gefangen. Und abgesehen davon: Wer ändert schon gerne was an einem System, in dem man es trotz allem „ganz nach oben“ geschafft und somit so viele andere hinter sich gelassen hat?
Ralf Neumann
(Illustr.: AdobeStock / Good Studio)
(Der Beitrag erschien bereits in leicht anderer Form unter „Inkubiert“ in unserer Print-Ausgabe 4/2021.)