„Why you shouldn’t use grant income to evaluate academics“ war der Titel des Kurzvortrags, den Dorothy Bishop, Professorin für Experimentelle Psychologie an der Universität Oxford, kürzlich bei einem Meeting zum Thema „Irresponsible Use of Research Metrics“ hielt. Darin räumte sie auf mit der allzu simplen Logik, aufgrund derer die Summe der eingeworbenen Forschungsmittel inzwischen ein immer größerer Evaluations-Faktor geworden ist.
Wer viel Geld bewilligt bekommt, der kann nicht schlecht sein – so der Kerngedanke dahinter. Zumal die Kandidaten mit den entsprechenden ja immer wieder jede Menge kritische Kollegen überzeugen muss. Ganz klar also: Wo nach eingehender Prüfung stetig Geld hinströmt, da muss auch Qualität sein.

Auch mit teurer Technologie erntet man bisweilen nur tiefhängende Früchte.
Bis heute, so stellt Dorothy Bishop dazu klar, habe man keinerlei belastbare Korrelation zwischen Antragshöhe und Antragserfolg feststellen können – unter anderem, da bei letzterem einfach zu viel Glück und Zufall im Spiel ist. Man würde daher vor allem dafür belohnt, wie viel Glück man hat. Und das sei letztlich ziemlich demoralisierend für die Forscher, da sie sich nicht auf faire Weise evaluiert fühlen.
Wir nahmen dies in einem früheren Blog-Beitrag einmal folgendermaßen aufs Korn: Diesen Beitrag weiterlesen »

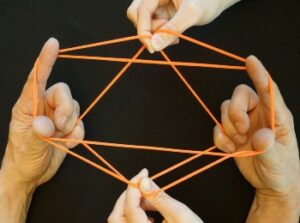
 Zählen wir mal alle diejenigen zusammen, die die akademische Welt sofort nach der Doktorarbeit oder dem ersten Postdoc ein für allemal verlassen. Oder gar mittendrin die Segel streichen. Damit wäre sicherlich bereits die klare Mehrheit all derer beisammen, die jemals eine Doktorarbeit oder einen Postdoc begonnen haben.
Zählen wir mal alle diejenigen zusammen, die die akademische Welt sofort nach der Doktorarbeit oder dem ersten Postdoc ein für allemal verlassen. Oder gar mittendrin die Segel streichen. Damit wäre sicherlich bereits die klare Mehrheit all derer beisammen, die jemals eine Doktorarbeit oder einen Postdoc begonnen haben.

 Einzig der Wahrheit seien Forscher und Forscherin verpflichtet. Und selbstlos seien sie dabei. Immer bestrebt, Wissen und Erkenntnis zu mehren. Nicht zum eigenen Ruhm, sondern allein zum Wohle aller. Soweit das hehre Ideal.
Einzig der Wahrheit seien Forscher und Forscherin verpflichtet. Und selbstlos seien sie dabei. Immer bestrebt, Wissen und Erkenntnis zu mehren. Nicht zum eigenen Ruhm, sondern allein zum Wohle aller. Soweit das hehre Ideal.



