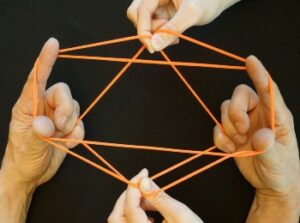
Ein großer Kritikpunkt im Rahmen der Bewältigung der Corona-Krise lautet, dass die Entscheidungen der Politik zu wenig evidenzbasiert zustandekommen. Dies wiederum – so die Kritiker weiter – liege jedoch mit daran, dass die medizinischen (und auch andere) Wissenschaften zu wenige Daten systematisch nach den Maßgaben der evidenzbasierten Medizin erheben. Mit der Folge, dass sich die Politikberatung nur selten auf echte und robuste Evidenz aus den (medizinischen) Wissenschaften stützen kann.
In seiner Kolumne „Von Botswana lernen, heißt im Kampf gegen Corona siegen lernen!“ schrieb etwa unser „Wissenschaftsnarr“ Ulrich Dirnagl dazu:
Wir haben eine Flut von Studien, die die Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen mittels statistischer Modellierung untersuchen – und nicht ganz überraschend zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. […] Dazu gibt es eine Flut von Beobachtungsstudien, welche die Effekte von Corona-Maßnahmen zum Gegenstand haben. Aber solche Beobachtungsstudien liefern nur schwache Evidenz und erlauben keine kausalen Schlussfolgerungen. Was wir deshalb bräuchten, sind randomisierte und kontrollierte Studien (RCT), in denen spezifische Corona-Maßnahmen als Intervention getestet werden. RCTs sind schließlich der Goldstandard zur Überprüfung therapeutischer Interventionen in der Medizin.
Aber ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Brauchen wir zu den diversen offenen Fragen der Corona-Pandemie tatsächlich nur systematisch Studien nach dem Goldstandard der evidenzbasierten Medizin durchführen – und alles wird gut?
Ganz sicher nicht, meint Trisha Greenhalgh, Professorin für Primary Care Health Science an der Universität Oxford, in einem aktuellen Editorial für PLoS Medicine. Mehr noch: Gleich in der Überschrift dreht sie den Spieß komplett um und stellt stattdessen die Gegenfrage: „Wird COVID-19 zur Nemesis der evidenzbasierten Medizin?“
Schauen wir uns die wichtigsten Abschnitte ihres Editorials an. Nach Trisha Greenhalgh beruht die evidenzbasierte Medizin auf bestimmten Annahmen – nämlich:
- einer singulären Wahrheit, die durch empirische Untersuchungen ermittelt werden kann;
- einer linearen Logik der Kausalität, in der Interventionen bestimmte Effektgrößen haben;
- einer Strenge (Rigor), die primär methodisch definiert ist – und wozu insbesondere eine Hierarchie bevorzugter Studiendesigns und Werkzeuge zur Erkennung von Bias gehört;
- und ein dekonstruktiver Ansatz zur Problemlösung, in dem die Evidenzbasis durch die Beantwortung fokussierter Fragen aufgebaut wird, die wiederum typischerweise als „PICO“ – also strukturiert nach Population, Intervention, Comparison und Outcome – formuliert werden.
Hierauf wendet Trisha Greenhalgh allerdings umgehend ein:
Das Problem bei Pandemien ist, dass diese Annahmen selten zutreffen. Ein Problem von der Größe einer Pandemie kann auf vielfältige Weise formuliert und angegangen werden. Einige Forschungsfragen rund um COVID-19, vor allem in Bezug auf Medikamente und Impfstoffe, lassen sich in randomisierten kontrollierten Studien untersuchen – und wo solche Studien möglich waren, wurden sie mit beeindruckender Geschwindigkeit und Effizienz durchgeführt. Aber viele Wissenslücken sind weit umfassender angelegt und lassen sich nicht auf PICO-artige Fragen reduzieren.
Gerade angesichts solcher umfassenden Fragen klinge die hübsche Schlichtheit eines kontrollierten Experiments mit und ohne Intervention, das eine definitive – das heißt, startistisch signifikante und weithin verallgemeinerbare – Antwort auf eine fokussierte Frage liefern soll, eher hohl. Insbesondere bevölkerungsweite Public-Health-Bemühungen wie sie in der Pandemie gefragt sind, seien laut Trisha Greenhalgh…
… typischerweise iterativ, lokal gewachsen und pfadabhängig, und sie verfügen über eine etablierte Methodik zur schnellen Bewertung und Anpassung. Die evidenzbasierte Medizin hat jedoch dazu tendiert, solche Designs als „geringe methodische Qualität“ einzustufen.
Diese Einschätzung sei in der Praxis des öffentlichen Gesundheitswesens schon seit einiger Zeit als Problem erkannt worden, so Trisha Greenhalgh weiter. Jetzt allerdings würden die Unzulänglichkeiten des Evidenz-Paradigmas zunehmend kritisch für den Erfolg der gesamten Corona-Mission – insbesondere da selbst erfahrene Wissenschaftler die hierarchische Vormachtstellung der Evidenz manchmal übertreiben.
Dafür bringt sie folgendes Beispiel:
Eine interdisziplinäre Gruppe von Wissenschaftlern der angesehenen Royal Society in Großbritannien hat kürzlich die Verwendung von Gesichtsmasken in der Öffentlichkeit überprüft und sich dabei auf Erkenntnisse aus der Laborwissenschaft, der mathematischen Modellierung und politischen Studien gestützt. Der Bericht wurde von Epidemiologen kritisiert, weil er „unsystematisch“ sei und politische Maßnahmen empfehle, ohne dass eine quantitative Schätzung der Effektgröße aus robusten randomisierten kontrollierten Studien vorliege.
Solche Kritik scheint zwei fragwürdige Annahmen zu treffen: Erstens, dass die genaue Quantifizierung der Auswirkungen dieser Art von Intervention sowohl möglich als auch wünschenswert ist, und zweitens, dass wir nichts tun sollten, solange wir keine Beweise aus randomisierten Studien haben.
Ihr Fazit daher:
Es ist sicherlich an der Zeit, sich einem zweckmäßigeren wissenschaftlichen Paradigma zuzuwenden. Die Theorie komplexer adaptiver Systeme geht davon aus, dass eine genaue Quantifizierung bestimmter Ursache-Wirkungs-Beziehungen sowohl unmöglich (weil solche Beziehungen nicht konstant sind und nicht sinnvoll isoliert werden können) als auch unnötig ist (weil es darauf ankommt, was in einer bestimmten realen Situation auftritt). Dieses Paradigma schlägt vielmehr vor, dass dort, wo mehrere Faktoren in dynamischer und unvorhersehbarer Weise interagieren, lebensnahe Methoden und eine schnelle Auswertung das bevorzugte Studiendesign sind. Die Logik der evidenzbasierten Medizin des 20. Jahrhunderts, in der Wissenschaftler das Ziel der Gewissheit, Vorhersagbarkeit und linearen Kausalität verfolgten, ist unter bestimmten Umständen nach wie vor nützlich (zum Beispiel bei den oben erwähnten Medikamenten- und Impfstoffstudien). Aber auf Populations- und Systemebene müssen wir die Erkenntnistheorie und die Methoden des 21. Jahrhunderts annehmen, um zu untersuchen, wie man am besten mit Ungewissheit, Unvorhersehbarkeit und nicht-linearer Kausalität umgehen kann.
In einem komplexen System lautet die Frage, die die wissenschaftliche Untersuchung antreibt, nicht „Wie groß ist der Effekt und ist er statistisch signifikant, nachdem andere Variablen kontrolliert wurden?“, sondern vielmehr: „Trägt diese Intervention zusammen mit anderen Faktoren zu einem erwünschten Ergebnis bei?“ Mehrere Interventionen könnten jeweils zu einem positiven Gesamteffekt durch heterogene Effekte auf unterschiedliche Ursachenpfade beitragen, auch wenn keine von ihnen einen statistisch signifikanten Einfluss auf eine vordefinierte Variable hätte. Um solche Einflüsse zu beleuchten, müssen wir Forschungsdesigns anwenden, die dynamische Interaktionen und Emergenz in den Vordergrund stellen. Dazu gehören eingehende Fallstudien mit gemischten Methoden (Primärforschung) wie auch narrative Übersichten (Sekundärforschung), die Zusammenhänge herausarbeiten und generative Kausalität im System hervorheben.
Allerdings gehe es nicht darum, die beiden Paradigmen der evidenzbasierten Medizin und der komplexen Systeme gegeneinander auszuspielen, sondern vielmehr darum, sie zusammenzuführen. Dazu sollten sie nicht weiter in einer hierarchischen Beziehung zueinander stehen, sondern in einer komplementären und rekursiven.
Für Trisha Greenhalgh scheint der Ball indes offenbar eher bei der evidenzbasierten Medizin zu liegen, um diese „Ent-Hierarchisierung“ anzustoßen, wenn sie im letzten Absatz schreibt:
In der aktuellen dynamischen Pandemie […] ist die Umsetzung neuer politischer Maßnahmen in Ermangelung randomisierter Studien ein wissenschaftlicher und moralischer Imperativ geworden. Obwohl es schwer ist, etwas in Echtzeit vorherzusagen, wird uns die Geschichte eines Tages sagen, ob das Festhalten an der „evidenzbasierten Praxis“ bei den Antworten des Gesundheitssystems auf COVID-19 geholfen oder sie behindert hat – oder ob eine scheinbare Lockerung der Standards, um der „praxisbasierten Evidenz“ Rechnung zu tragen, letztendlich eine effektivere Strategie war.
Es ist also sicherlich sinnvoll, kritisch zu hinterfragen, wo die evidenzbasierte Medizin womöglich eher nicht das Maß aller Dinge sein könnte. Und es könnte dabei tatsächlich herauskommen, dass am Ende weniger „Goldstandard“ übrig bleibt, als deren Anhänger sich heute eingestehen würden. Aber ob das dann gleich die Ausmaße einer „Nemesis“ für die evidenzbasierte Medizin annehmen muss,…?
Ralf Neumann
(Foto: fadenspielmobil.de)
Schlagworte: Corona-Krise, Corona-Maßnahmen, Corona-Pandemie, Evidenz, evidenzbasierte Medizin, Gesundheitswesen, komplexe Systeme, Public health, randomisiert, RCT, Wisenschaftstheorie





