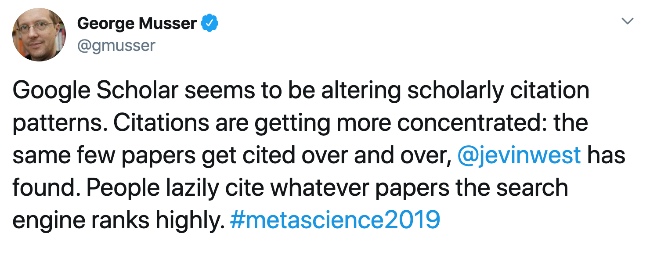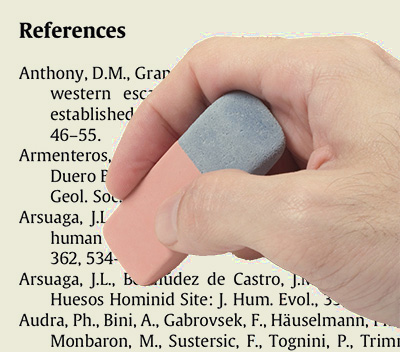 Es gibt Dinge, die ärgern Forscher ganz besonders. Mit zu den „Highlights“ gehört sicherlich, wenn man ein frisches Paper liest, dessen Inhalt klar erfordert, dass es die ein oder andere eigene Arbeit zitiert — aber nichts, nicht ein einziges Mal wird man in der Referenzliste erwähnt.
Es gibt Dinge, die ärgern Forscher ganz besonders. Mit zu den „Highlights“ gehört sicherlich, wenn man ein frisches Paper liest, dessen Inhalt klar erfordert, dass es die ein oder andere eigene Arbeit zitiert — aber nichts, nicht ein einziges Mal wird man in der Referenzliste erwähnt.
Manchmal ruft man daraufhin den verantwortlichen Autor an. Schließlich arbeitet er im gleichen Feld, und man kennt sich ja. Doch die Antwort, die man dann bisweilen erhält, lässt den Forscherkamm nur noch dicker anschwellen:
„Ja, tut mir leid. Das war uns natürlich bewusst. Aber das blöde Journal akzeptiert nur maximal 25 Referenzen — da mussten wir zwangsweise das eine oder andere wichtige Paper weglassen.“
Ganz toll! Und dann fügt er noch hinzu:
„Weißt du, was mir zuletzt mit einem anderen Paper passiert ist? Da hat das Journal die Referenzliste sogar eigenmächtig auf Layout-freundliches Maß zurechtgestutzt.“
Geht‘s eigentlich noch?
Um das jetzt mal ganz klarzumachen: Life-Science-Forschung ist ein derart vielfältiges Gebiet, da können die Verlage unmöglich einfach mal festlegen, dass sich ein jedes Paper auf dieser Erde auf den Ergebnissen von nicht mehr als 25 oder 30 Referenzen aufbauen ließe. Manche brauchen die Vorarbeit von mehr als hundert, wobei jedes einzelne davon zu Recht in der Referenzliste steht!
Und ganz abgesehen davon: Sollte es nicht zu den Hauptaufgaben der Forschungsblätter gehören, dem geneigten Leser die Möglichkeit zu bieten, genauestmöglich nachvollziehen zu können, auf wessen „Schultern“ die präsentierten Ergebnisse tatsächlich stehen?
Klar, eine weitere Schlüsselaufgabe der Gutachter ist natürlich, gleichsam unnötige oder unverdiente Referenzen wieder auszusortieren — gerade um nicht immer ganz lautere „Überzitierung“ zu vermeiden. Aber hier geht es um die vorweg festgelegten Limits für die Referenzlisten — und die sind oftmals viel zu niedrig.
Was daraus resultiert, klingt fast schon wie ein schlechter Witz: Für die Forscher sind Zitierungen heute so wichtig wie noch nie (wenn auch infolge eines zugegebenermaßen fehlgeleiteten Belohnungssystems) — während die Zeitschriften mit solchen schmalspurigen Maßnahmen den tieferen Zweck des wissenschaftlichen Referenzierens mit Füßen treten.
Ralf Neumann
(Eine etwas andere Version dieses Textes erschien bereits in unserer Printausgabe Laborjournal 12/2015.)
x