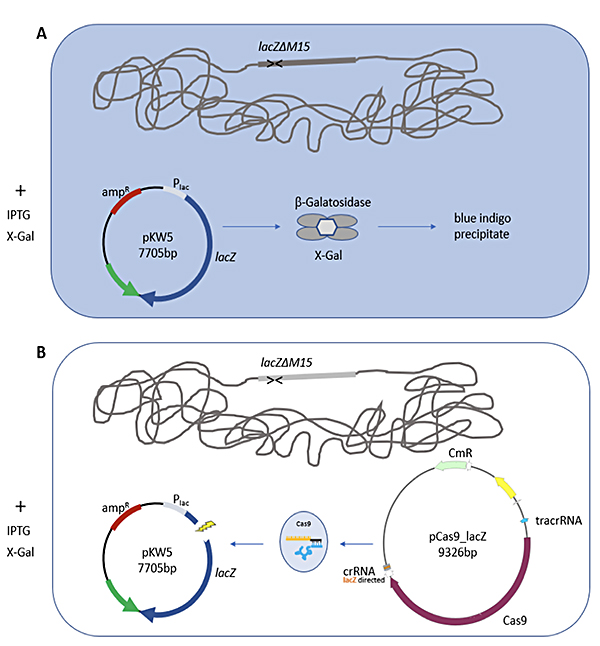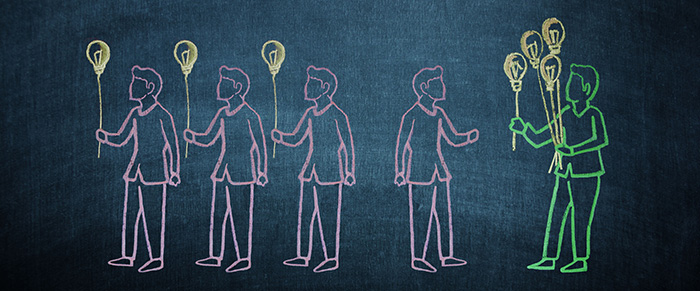Was ist wichtiger in der Forschung: Antworten zu finden oder die richtigen Fragen zu stellen? Viele favorisieren Letzteres, da sie Fragenstellen in einem Aufwasch sehen mit dem nachfolgenden Formulieren testbarer Hypothesen. Und Hypothesen gelten ja schließlich als das Kernstück der Forschung schlechthin.
Hand auf’s Herz, wie oft sind Sie tatsächlich zu diesem Kern vorgestoßen? Wie oft haben Sie tatsächlich eine Hypothese formuliert?

Anhand dieser Frage lassen sich womöglich grob vier Klassen von Forscherinnen und Forschern einteilen:
1) Diejenigen, die erstmal gar keine Hypothesen aufstellen wollen. Stattdessen sammeln sie blind (sie selber sprechen lieber von vorurteilsfrei) Daten, einfach weil es technisch geht. Siehe etwa Metagenom-Projekte und Co. Standard-Spruch dieser Spezies: „Wir liefern Daten, aus denen man dann charakteristische Muster herauslesen kann — und mit denen kann man dann wiederum Hypothesen aufstellen.“ „Hypothesen-generierende Forschung“ nennt sie das Ganze dann.
2) Diejenigen, die sich an gängige Hypothesen dranhängen. Sie bestätigen hier ein Detail oder fügen dort eines hinzu, entwickeln kaum eigene Hypothesen, machen noch weniger Vorhersagen und testen am Ende praktisch gar nichts.
3) Diejenigen, die sich Hypothesen förmlich abringen. Diese erlauben sogar einige testbare Voraussagen, jedoch reicht dies gerade, um die eigene Forschung am Laufen zu halten. Deshalb werden sie eifersüchtig gehortet — und man bekommt sie erst nach vielen Tests glatt poliert im fertigen Paper präsentiert.
4) Diejenigen, die mehr gute Hypothesen samt testbarer Vorhersagen aufstellen, als sie selbst bearbeiten können — und diese daher auch mitteilen. Diese seltene Spezies beginnt dann auch mal einen Vortrag mit: „Hört zu, ich hab’ mir die Literatur zum Thema X angeschaut, darüber nachgedacht und ein paar vorläufige Experimente gemacht. Von daher scheint mir, dass die ganze Story so und so geht. Allerdings, sicher bin ich mir natürlich nicht — also lasst uns das mal gemeinsam durchdenken…“ Oder macht es wie der Zürcher Entwicklungsbiologe Konrad Basler, der vor einigen Jahren in der PLoS Biology-Rubrik „Unsolved Mysteries“ für alle Kollegen eine umfassende Arbeitshypothese zur Evolution des Hedgehog-Signalwegs samt einer ganzen Reihe abgeleiteter und testbarer Vorhersagen vorgestellt hat (Bd. 7(6): e1000146).
Keine Frage, sind es Momente wie die letzteren, in denen deutlich wird, dass das Hypothesenaufstellen tatsächlich das Herzstück der Wissenschaft ausmacht.
Ralf Neumann
(Zeichnung: Peter Kapper)