Gerade entwickelte sich hier in der Redaktion eine ganz nette Diskussion…
Gestern hatte unsere Mitarbeiterin Juliet Merz auf Laborjournal online über den enorm hohen Salzgehalt im Blut der ach so flinken Galápagos-Meeresechsen aus der Art Amblyrhynchus cristatus berichtet. Darin schrieb sie unter anderem:
Die Autoren schätzen den Natriumgehalt im Blut der Reptilien sogar noch höher ein: Denn das verwendete Messgerät konnte nur eine maximale Konzentration von 180 mmol/L ermitteln — und bei 15 Tieren schlug die Messung an dieser Grenze an.
Daraufhin meinte Kollege Köppelle heute:
Äh… woher wissen die Forscher das denn? Der Wert dieser 15 Tiere könnte jeweils exakt 180 mmol/L betragen haben, oder 180,1 mmol/L, oder auch mal 180 und mal 190 und mal 500 oder auch dreitausend mmol/L … Letzteres natürlich eher nicht — aber wo man nichts messen kann, kann man auch nichts aussagen.
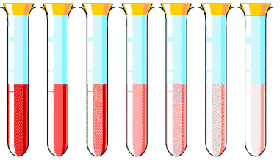 Na ja, das ist vielleicht etwas zu hart. Denn dass man den Natriumgehalt im Blut daher wohl tatsächlich noch etwas höher ansetzen muss, ist ja schon sehr plausibel. Niedriger jedenfalls ganz gewiss nicht.
Na ja, das ist vielleicht etwas zu hart. Denn dass man den Natriumgehalt im Blut daher wohl tatsächlich noch etwas höher ansetzen muss, ist ja schon sehr plausibel. Niedriger jedenfalls ganz gewiss nicht.
Ich hatte in dieser Sache jedoch einen anderen Einwand:
Warum haben die nicht einfach verdünnt und das Ergebnis mit dem Verdünnungsfaktor wieder hochgerechnet? Lernt man doch im ersten Laborpraktikum, dass man Proben so verdünnen muss, dass die Konzentration des gewünschten Parameters in den Messbereich des Gerätes fällt…
Daraufhin Kollege Köppelle:
Stimmt, hätte man auch machen können. Jedenfalls ein Grund, nochmal nachzurecherchieren und den Artikel nachzubessern.
Gesagt, getan. Und tatsächlich steht bereits im Abstract des zitierten Original-Papers:
A notable finding was the unusually high blood sodium level; the mean value of 178 mg/dl is among the highest known for any reptile. This value is likely to be a conservative estimate because some samples exceeded the maximal value the iSTAT can detect.
Und in „Material und Methoden“ wird das Ganze folgendermaßen erklärt:
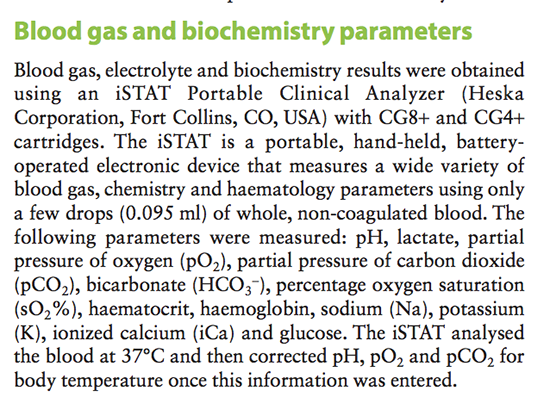
Worauf Kollege Köppelle meinte:
Ah, das ist offenbar irgendsoein Cartridges-benutzendes Dingens:
https://www.abbottpointofcare.com/products-services/istat-handheld
Aber man muss zuvor per Hand das Blut in die Cartridge füllen.
Fazit: Die waren also bloß zu faul, nochmal ins Feld zu fahren, nochmal Blutproben zu nehmen und dann ohne ihr ach so praktisches MultiAutoTool im Labor die Werte „althergebracht“ zu analysieren!
Mein Einwand wiederum:
Wahrscheinlich hatten sie auf den Inseln nix dabei, um Blutproben einfrieren zu können. Allerdings kommen vier der acht Autoren von der „University San Francisco de Quito, Galápagos Science Center, Puerto Baquerizo Moreno, Galápagos, Ecuador“. Die dürften es also nicht allzu weit ins Labor gehabt haben…
Wie auch immer. Der Eindruck bleibt, dass man diese Messung durchaus genauer hätte machen können — wenn die Autoren nur gewollt hätten. Kollege Köppelle und ich waren uns jedenfalls einig, dass sie froh sein können, uns beide nicht als Gutachter bekommen zu haben … 😉

 Der Großteil an Personal- und Projektmitteln wird inzwischen bekanntermaßen befristet vergeben. Und die Fristen sind zuletzt ziemlich kurz geworden. Was folgt, ist auch bekannt: Doktoranden, Postdocs und alle anderen, die noch nicht am Ende der Karriereleiter angekommen sind, brauchen Veröffentlichungen, um es nach dem Ablauf der aktuellen Bewilligungsrunde hinüber in die nächste zu schaffen. Und auch was dies bewirkt, liegt auf der Hand: Der Ehrgeiz der angehenden bis fortgeschrittenen Jungforscher ist immer weniger darauf ausgerichtet, möglichst robuste und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, sondern zunehmend darauf, so schnell wie möglich irgendwelche Veröffentlichungen zu produzieren.
Der Großteil an Personal- und Projektmitteln wird inzwischen bekanntermaßen befristet vergeben. Und die Fristen sind zuletzt ziemlich kurz geworden. Was folgt, ist auch bekannt: Doktoranden, Postdocs und alle anderen, die noch nicht am Ende der Karriereleiter angekommen sind, brauchen Veröffentlichungen, um es nach dem Ablauf der aktuellen Bewilligungsrunde hinüber in die nächste zu schaffen. Und auch was dies bewirkt, liegt auf der Hand: Der Ehrgeiz der angehenden bis fortgeschrittenen Jungforscher ist immer weniger darauf ausgerichtet, möglichst robuste und reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten, sondern zunehmend darauf, so schnell wie möglich irgendwelche Veröffentlichungen zu produzieren.




