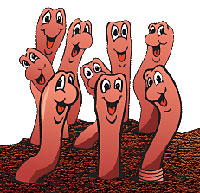 Welches Maß an genetischen Unterschied braucht es, um eindeutig zwei Spezies voneinander zu trennen?
Welches Maß an genetischen Unterschied braucht es, um eindeutig zwei Spezies voneinander zu trennen?
Bleiben wir zunächst bei uns. Die Genome zweier beliebiger Menschen unterscheiden sich in knapp einem Prozent ihrer Sequenzen — offenbar zu wenig für zwei unterschiedliche Arten. Mit dem Schimpansen dagegen teilen wir uns im Schnitt 96 Prozent des Genoms. Bleibt man nur dabei, so müsste man folgern, dass irgendwo auf dem Weg von 99 runter zu 96 Prozent Sequenzübereinstimmung die genetische Artgrenze überschritten wird. Jetzt unterscheidet sich aber ein Schimpanse in seiner Sequenz von seinem eigenen Artgenossen bereits genau so sehr wie die beiden Spezies Mensch und Neanderthaler. Es scheint also komplizierter zu sein.
Wenn wir den Blick nur ein wenig ausweiten, stellen wir schnell fest: Es ist viel komplizierter! Bereits 2004 schrieben wir in Laborjournal print (Vol. 1-2/2004: 24):
Wiewohl Faustregeln zu einer molekularen Spezies-Differenzierung bereits existieren, kann eine Artabgrenzung allein aufgrund der Menge an Basenunterschieden schwer in die Irre führen. Eindrucksvollstes Beispiel hier: Die berühmten Artenschwärme der ostafrikanischen Buntbarsche oder Cichliden. Allein im Victoriasee gibt es über fünfhundert morphologisch durchaus verschiedene Buntbarsch-Arten, dennoch sind diese genetisch deutlich homogener als etwa die Variationen unter den menschlichen Populationen. Ganz zu schweigen von denjenigen unter den vielen Rassen der einen Art „Hund“, bei denen die innerartliche Variation durch die unnatürlichen Zuchtverhältnisse wohl am weitesten getrieben wurde — sowohl phänotypisch, als auch genetisch.
Welches Kriterium man auch nimmt, die alte Kernfrage bleibt folglich bestehen: Welcher Grad an Unterschieden reicht aus, um zwei Organismen zwei verschiedenen Arten zuzusprechen? Und bis zu welchem Grad handelt es sich umgekehrt um die Variation zwischen zwei Populationen dergleichen Spezies? Fragen, die sich ziemlich wahrscheinlich niemals allgemeingültig beantworten lassen.
Den jüngsten Beleg für diese Prognose liefert jetzt ein Paper kanadischer Evolutionsbiologen in PNAS (vol. 110: 11056-60), in dem sie nach Sequenzanalyse des Nematoden Caenorhabditis brenneri festhalten:
Here we demonstrate that C. brenneri harbors the most molecular diversity of any eukaryote, with its 14.1% of polymorphic synonymous sites between individuals being 150-fold greater than humans and most comparable to hyperdiverse bacteria. This diversity is not an artifact of cryptic species divergence but reflects an enormous pan-tropical population, confirmed by fully viable genetic crosses between continents, extensive intralocus recombination, selection on codon use, and only weak geographic genetic structure.
„Molekulare Hyperdiversität“ nennen die Autoren das Phänomen. Und mit der nach Sydney Brenner benannten Wurmspezies samt seinen über 14 Prozent individuellen Sequenzunterschieden haben sie den klaren bisherigen Rekordhalter in dieser „Disziplin“ — zumindest unter den Eukaryoten.
Die Wahrscheinlichkeit, dass es kein allgemeines Maß an Genomsequenz-Unterschieden gibt, wodurch sich zwei Arten klar voneinander trennen lassen, ist wohl nicht erst damit zur Gewissheit geworden.
Schlagworte: Artbegriff, Caenorhabditis, Diversität, Genom, Maß, Population, Sequenzunterschiede, Spezies





