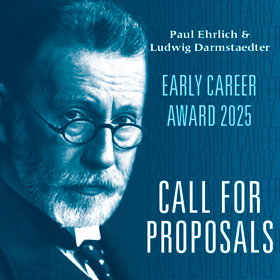Special Gene Editing
Vom therapierten zum optimierten Mensch?
Interview: Juliet Merz, Laborjournal 09/2017
Genome Editing erlebt seit der Entdeckung von CRISPR/Cas im Jahr 2012 neuen Aufschwung. Doch neben den vielversprechenden Möglichkeiten bergen die neuen Techniken nach wie vor Risiken – insbesondere wenn man die klinische Anwendung anpeilt. Toni Cathomen, Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie der Uniklinik Freiburg, hat mit Laborjournal gesprochen – über Chancen, Schwierigkeiten und Zukunftsmusik der Genomeditierung.
Laborjournal: Herr Cathomen, bringen Sie uns auf den neusten Stand. Mit welchen Werkzeugen arbeiten Genomeditierer aktuell am häufigsten?
Toni Cathomen » Am wichtigsten sind sicherlich die Genscheren, von denen es drei Hauptklassen in die Klinik geschafft haben: Die Zinkfinger-Nukleasen, die transcription activator-like effector-Nukleasen, kurz TALENs, und die CRISPR/Cas-Nukleasen. Allerdings darf man bei den CRISPR/Cas-Nukleasen noch mal differenzieren zwischen dem CRISPR/Cas9-System, das 2012 das erste Mal beschrieben wurde, und dem „zwei Jahre alten“ CRISPR/Cpf1-System. Dieses ist insbesondere für die therapeutische Applikation sehr interessant, weil mehrere Publikationen zeigen konnten, dass CRISPR/Cpf1 spezifischer ist als CRISPR/Cas9.
Wie funktionieren diese Werkzeuge?
Cathomen » Grundsätzlich bestehen Genscheren aus zwei unterschiedlichen Domänen. Die eine ist für die Erkennung der Zielsequenz zuständig und eine zweite, die Nukleasedomäne, schneidet die DNA. Die Zinkfinger-Nukleasen und TALENs sind rein Protein-basiert: Sowohl DNA-Erkennung als auch DNA-Schneiden werden durch Proteine durchgeführt. Bei CRISPR/Cas hingegen erkennt ein kurzes RNA-Stück – die Leit-RNA oder guide RNA – die DNA. Die Nukleasedomäne selbst ist dann wieder ein Protein.
Trotz des unterschiedlichen Aufbaus ist das Ergebnis der Nukleasen aber dasselbe: ein Doppelstrangbruch. Inwieweit unterscheidet sich die Qualität der Scheren?
Cathomen » Es kommt natürlich immer darauf an, wie viel Arbeit man investiert, um eine gute Nuklease herzustellen. Nimmt man sich die Zeit, dann unterscheiden sich die verschiedenen Nukleasen bezüglich der Aktivität kaum. Bei der Spezifität ist das anders. Die CRISPR/Cas-Systeme sind bis heute von allen Genscheren am besten untersucht worden – und man weiß: die Spezifität könnte besser sein. Die CRISPR/Cpf1-Systeme hingegen sind fortgeschrittener.
Woran erkennen Sie, ob eine Nuklease sehr spezifisch ist?
Cathomen » An den Off-Targets (Anm. d. Red.: fälschlicherweise geschnittene Sequenzen), die es bei CRISPR/Cpf1 kaum zu geben scheint.
Und wie sieht es mit Zinkfinger-Nukleasen und TALENs aus?
Cathomen » Auch hier entscheidet der Arbeitsaufwand bei der Produktion. Unsere eigenen Erfahrungen mit TALENs zeigen, dass sie sehr spezifisch sein können. Zinkfinger-Nukleasen hingegen haben wir schon lange keine mehr hergestellt. Allerdings werden diese bereits in der Klinik angewendet, weshalb ich davon ausgehe, dass ihre Spezifität sehr hoch sein muss. Obwohl es eine Zinkfinger-Nuklease für die Behandlung von HIV in die klinische Anwendung geschafft hat, wurde publiziert, dass die Spezifität dieser Zinkfinger-Nuklease noch Luft nach oben hat. Das heißt, dass tatsächlich auch deutliche Off-Target-Aktivitäten nachgewiesen worden sind.
Wir haben gerade schon besprochen, dass die Genscheren die DNA schneiden. Was passiert anschließend?
Cathomen » Nachdem die Nuklease einen spezifischen Doppelstrangbruch in unserem Ziellokus gesetzt hat, aktiviert dieser Vorgang DNA-Reparaturprozesse. Nun kann man zwischen zwei Hauptprozessen unterscheiden: die nicht-homologe Endenverknüpfung, auf Englisch nonhomologous end-joining (Anm. d. Red.: abgekürzt NHEJ), und die Homologie-vermittelte Reparatur, auf Englisch homology-directed repair (Anm. d. Red.: abgekürzt HDR).
Wie unterscheiden sich diese Reparaturprozesse?
Cathomen » NHEJ erfolgt nicht immer präzise, denn es kommt bei der Bruchstelle häufig zu kleinen Insertionen und Deletionen. Deshalb setzen wir diesen Reparaturweg hauptsächlich ein, wenn wir Genfunktionen ausschalten wollen, denn die häufig vorkommenden Insertionen und Deletionen führen zu einem funktionellen Knock-out. HDR hingegen basiert auf der homologen Rekombination. Zusätzlich zur Nuklease bringen wir in die Zelle einen sogenannten DNA-Donor ein, welcher zur Zielsequenz homolog sein muss. Die Sequenzinformation des Donors wird anschließend in das Erbgut der Zelle übertragen. Weil HDR sehr präzise ist, können wir diesen Weg einsetzen, um Gene zu korrigieren, zum Beispiel bei Mutationen, die eine Erbkrankheit auslösen.
Noch mal zu NHEJ: Wenn dieser Prozess so fehleranfällig ist, warum „macht“ das die Zelle überhaupt?
Cathomen » Im Vergleich zu HDR ist NHEJ ein extrem schneller DNA-Reparaturprozess. Wenn ein Doppelstrangbruch natürlicherweise oder durch Nukleasen induziert vorkommt, ist es für die Zelle am wichtigsten sicherzustellen, dass das Chromosom nicht auseinanderbricht. Denn das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Die Zelle muss also extrem schnell reagieren. In diesem Fall ist es nicht tragisch, wenn die Reparatur nicht so präzise ist. Während der DNA-Replikation in der S-Phase hingegen, ist das natürlich etwas anderes. Zu diesem Zeitpunkt entstehen sehr oft Doppelstrangbrüche, weil die DNA aufgetrennt wird um den Einzelstrang zu vermehren. Dann ist es vor allem wichtig, korrekt mit HDR zu reparieren.
Für die Klinik hat NHEJ aber einen entscheidenden Vorteil: Sie kann Knock-outs induzieren. Können Sie Beispiele nennen, wo die Technik eingesetzt wird?
Cathomen » Mir würden spontan drei interessante Beispiele einfallen. Vorhin habe ich die HIV-Studie schon kurz erwähnt. Das HI-Virus dringt mit Hilfe des Hauptrezeptors CD4 und einem von zwei Co-Rezeptoren – CCR5 oder CXCR4 – in die Zelle ein. Wobei die meisten HI-Virusstämme an CCR5 andocken.
Nun können wir CCR5 genetisch ausschalten. Auf die Idee ist man gekommen, weil es Menschen mit einer natürlichen Mutation in eben diesem Gen gibt. Diese Personen leben fast ausschließlich in Nord- und Osteuropa, sind kerngesund und zudem resistent gegen Infektionen mit dem HI-Virus. Dieses Wissen kann man sich zunutze machen, indem man Blutstammzellen entnimmt, das CCR5-Gen in ihnen ausschaltet und den HIV-Patienten nach einer Chemotherapie diese Blutstammzellen transplantiert. Aus den Gen-editierten Blutstammzellen entsteht dann ein HIV-resistentes Immunsystem.
Hat CCR5 im Organismus keine Funktion?
Cathomen » Die genaue Funktion von CCR5 ist nicht geklärt. Wahrscheinlich ist CCR5 noch wichtig für das menschliche Immunsystem, weil die Mutation eben nur in Nord- und Osteuropa vorkommt – sonst nirgendwo auf der Welt. Epidemiologische Studien zeigen, dass CCR5 für die Abwehr bestimmter Viren wichtig ist. Dazu gehört das West-Nil-Virus, welches hauptsächlich in der südlichen Hemisphäre und im Süden der USA vorkommt.
In den genannten Gebieten wäre dieser Therapie-Ansatz also keine Lösung?
Cathomen » In West-Nil-Virus-Endemiegebieten müsste für jeden Patienten eine sorgfältige Risikoabwägung durchgeführt werden, denn fehlt CCR5, kann eine solche Infektion einen schweren Verlauf nehmen.
Sie wollten noch zwei andere Anwendungs-Beispiele nennen.
Cathomen » Ja genau, ein zweites Beispiel bezieht sich auf die Krebstherapie. Man kann patienteneigene T-Zellen, mit einem CAR-Molekül ausrüsten. Diese CAR, also chimären Antigen-Rezeptoren, erkennen Tumorantigene oder tumorassoziierte Antigene und können dadurch die Zerstörung der Tumorzelle einleiten. Das funktioniert sehr gut bei bestimmten Leukämien und Lymphomen, allerdings noch nicht bei soliden Tumoren, da diese eine Mikroumgebung bilden, die das Immunsystem davon abhält, den Tumor zu eliminieren. Um diese Hürde zu überwinden, können Immun-Checkpoint-Inhibitoren in den CAR-T-Zellen genetisch ausgeschaltet werden. Da diese Immun-Checkpoints die Immunantwort gegen die Krebszellen bremsen, greifen die CAR-T-Zellen nach einem entsprechenden Knock-out den Tumor aggressiver an. Dieser Ansatz ist bereits in der klinischen Erprobung, Daten dazu gibt es allerdings noch nicht. Aus Mausexperimenten weiß man aber, dass solche CAR-T-Zellen tatsächlich aggressiver sind und den Tumor effizienter wegräumen.
Dann wollte ich Ihnen noch ein drittes Beispiel nennen: Bei Erbkrankheiten, die autosomal dominant vererbt werden, können Nukleasen allelspezifisch hergestellt werden. Die Nukleasen unterscheiden dann zwischen gesundem und krankem Allel und können das kranke gezielt ausschalten, sodass nur noch das gesunde zur Expression kommt.
Können Sie ein Beispiel für eine solche Krankheit nennen?
Cathomen » Das autosomal dominante Hyper-IgE-Syndrom, abgekürzt AD-HIES. Dominante Mutationen im STAT3-Gen lösen diese Erbkrankheit aus. Wenn wir das Allel mit der dominanten Mutation ausschalten, können wir damit vermutlich einen Therapieerfolg herbeiführen.
Zurück zu den Reparaturprozessen: Kann man in einer Zelle beeinflussen, ob NHEJ oder HDR abläuft? Unabhängig von der Beigabe eines Donors?
Cathomen » Wir wissen aus DNA-Reparatur-Analysen und -Studien, dass NHEJ immer aktiv ist und HDR wie erwähnt nur kurz vor der Zellteilung während der DNA-Replikation. Das heißt im Umkehrschluss, dass HDR sehr wahrscheinlich nur gut funktioniert, wenn die Zelle sich teilen kann oder sich tatsächlich teilt. Somit ist HDR viel schwieriger für die Genomeditierung „einzufangen“ als NHEJ. Mit NHEJ können wir 90 Prozent der Allele verändern, über HDR sind es nur 10 bis 20 Prozent.
Wie gelangen die Werkzeuge denn überhaupt in die Zelle?
Cathomen » Jetzt müssen wir unterscheiden, ob wir eine Genomeditierung in vivo oder ex vivo durchführen wollen. Beim Ex-vivo-Ansatz entnehmen wir dem Patienten beispielsweise bei der HIV-Therapie Blutstammzellen oder bei der Krebstherapie CAR-T-Zellen und bringen sie in Kultur. Die Genscheren schleusen wir anschließend meistens durch Elektroporation in Form von mRNA ein. Bei CRISPR/Cas belädt man vorzugsweise das Cas9-Protein mit der Leit-RNA und transfiziert den Proteinkomplex direkt in die Zelle. In-vivo-Ansätze sind schwieriger. Um die Zellen im Körper zu erreichen, müssen meist Virusvektoren eingesetzt werden, wie zum Beispiel Adeno-assoziierte Viren. Durch diese Methode können wir die Werkzeuge gut in Leberzellen, bestimmte Kompartimente des Auges und Muskelzellen einbringen. Andere Bereiche des Körpers sind viel schwieriger zu erreichen, wie zum Beispiel das zentrale Nervensystem oder die Lunge.
Warum gerade die Lunge?
Cathomen » Die Lunge scheint von außen recht gut zugänglich zu sein. Allerdings hat sie gelernt, sich effektiv gegen Krankheitserreger von außen zu schützen. Deshalb ist sie von der Atemwegsseite kaum zu transduzieren und falls man Zellen erreicht, sind diese in der Regel nur sehr kurzlebig. Das zeigen Gentherapie-Studien zu Mukoviszidose. Eine Möglichkeit ist wahrscheinlich, von der Blutseite her zu transduzieren. Aber auch da ist es nicht ganz trivial, weil vieles, was wir in die Blutbahn spritzen, von der Leber aussortiert wird – so auch die Virusvektoren.
Da ist also auf Organ- und Zellebene aktuell Schluss. In einem größeren Kontext: Bei welchen Krankheiten stößt Genome Editing an seine Grenzen?
Cathomen » Nicht behandelbar sind Krankheiten, bei der jede einzelne Zelle im Körper korrigiert werden müsste. Ich denke da zum Beispiel an Mutationen im p53-Gen, die mit einem sehr hohen Krebsrisiko einhergehen. Um in diesem Fall einen Therapieerfolg zu erzielen, müsste man jede einzelne Zelle im Körper korrigieren. Das ist illusorisch. In ferner Zukunft könnte das möglich sein, aber aktuell ist das ein Ding der Unmöglichkeit.
Wir haben bezüglich der Genscheren schon über das Risiko der Spezifität gesprochen, gibt es noch andere Schwierigkeiten?
Cathomen » Obwohl es noch nicht gezeigt wurde, kann ich mir als weiteres Risiko die Immunotoxizität vorstellen. Denn wenn Sie In-vivo-Genomeditierung durchführen, dann müssen Sie Werkzeuge in den Menschen einbringen, die von unserem Immunsystem sofort als fremd erkannt werden. Ich könnte mir zum Beispiel bei einer Genomeditierung in der Leber vorstellen, dass das Immunsystem Zellen erkennt, die Genscheren exprimieren, und die korrigierten Leberzellen dann abstößt. Wie gesagt, das ist ein theoretisches Risiko, das so noch nicht publiziert wurde. Allerdings haben wir noch relativ wenige Daten bezüglich Genomeditierung in klinischen Studien. Deshalb können wir auch die Langzeitfolgen nur schwer abschätzen. Was wir wissen ist, dass Off-Target-Effekte erst nach Jahren wirklich sichtbar werden. Deshalb brauchen wir dringend Langzeitstudien und Langzeit-Nachbeobachtungsstudien.
Wie versuchen Forscher aktuell das Risiko von Off-Targets zu minimieren?
Cathomen » Dazu brauchen wir erst einmal gute Methoden, um Off-Targets überhaupt detektieren zu können. Erst dann können wir die Genscheren verbessern. Inzwischen gibt es glücklicherweise einige sehr gute Methoden, die auf Next Generation Sequencing also Hochdurchsatz-Sequenzierverfahren beruhen. Dadurch können wir überprüfen, was an bestimmten Stellen im Erbgut passiert, indem wir gezielt bestimmte Genombereiche absequenzieren.
Und damit Risiken vorher einschätzen?
Cathomen » Genau. Und wir haben Hilfsmittel, um eine gute von einer schlechten Genschere unterscheiden und ihre Spezifität einschätzen zu können. Ein Restrisiko bleibt immer, weil all diese Nachweismethoden eine Sensitivität von 0,1 Prozent haben. Damit sind infrequente Off-Target-Aktivitäten nicht mehr nachweisbar und deshalb brauchen wir in Zukunft dringend biologische Assays. Aktuell gibt es die leider noch nicht, weil ihre Entwicklung extrem komplex ist. Soweit ich weiß, arbeiten bereits viele Labore daran – trotzdem bleibt es eine sehr große Herausforderung.
Gibt es neben der Therapie von Krankheiten noch andere Anwendungsgebiete, in denen Genome Editing zum Einsatz kommt?
Cathomen » In der Transfusionsmedizin ist die Genomeditierung von induzierten pluripotenten Stammzellen (Anm. d. Red.: kurz iPS-Zellen) sehr interessant. Es gibt viele Ansätze, in denen aus iPS-Zellen bestimmte Blutprodukte hergestellt werden, wie zum Beispiel Erythrozyten oder Thrombozyten. Durch Genomeditierung könnten wir universal verträgliche Blutprodukte, wie etwa 0-negative Erythrozyten-Konzentrate herstellen. Oder in Thrombozyten können wir bestimmte Gewebe-Merkmale genetisch so verändern, dass auch sie universal verträglich sind. Das wird zukünftig die Blutversorgung wesentlich vereinfachen. Denn gerade die Zahl der jungen Menschen, die Blut spenden, wird immer weniger, obwohl wir gleichzeitig immer mehr Blutprodukte brauchen. Die Zukunft liegt meiner Meinung nach in der Herstellung von Blut im Reagenzglas.
In den letzten Wochen wurde die Diskussion um Genomeditierung erneut entfacht. Auslöser war das Nature-Paper von Ma et al. (548: 413-9), in welchem die Forscher beschrieben, wie sie erfolgreich einen erblichen Herzfehler in einem Embryo durch CRISPR/Cas therapieren konnten. Welche Auswirkungen hat die Veröffentlichung?
Cathomen » Ich kann die Sorgen, die durch die Ergebnisse ausgelöst wurden, durchaus nachvollziehen. Denn wenn wir diese Technologien in der Keimbahn oder im menschlichen Embryo einsetzen, bewegen wir uns weg vom therapierten zum optimierten Menschen. Es ist sehr wichtig, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion führen, wie wir Genomeditierungs-Technologien in der Zukunft einsetzen wollen und dass jedes Land eine rote Linie zieht, die nicht überschritten werden darf. Da stehen wir noch ganz am Anfang der Debatte. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass die Technologie sich schneller entwickelt und Tatsachen schafft, bevor wir die Diskussion wirklich zu Ende gebracht haben. Denn je mehr Fakten geschaffen werden, desto schwieriger wird es, die Diskussion noch nachzuziehen und zu einem brauchbaren Ergebnis zu kommen.
Welchen Schluss können wir aus dem Experiment ziehen?
Cathomen » Ich glaube, wir haben aus dem Experiment schon sehr viel gelernt. Zum einen, dass die DNA-Reparaturprozesse in einem ganz frühen embryonalen Stadium ganz anders verlaufen als in der entwickelten Körperzelle. In unseren Körperzellen scheint NHEJ viel effizienter zu sein als HDR. Im Einzell-Embryo hingegen scheint das umgekehrt zu sein: Jeder Doppelstrangbruch wird über HDR korrigiert und interessanterweise dient das zweite Allel als Reparaturvorlage – und nicht etwa ein hinzugefügter Donor, denn dieser wird ignoriert. Sprich, wenn der Doppelstrangbruch im väterlichen Allel gesetzt wurde, nimmt der Embryo das mütterliche Allel als Vorlage – und umgekehrt. Das kennen wir so aus Körperzellen nicht. Das ist bestimmt eine Kernaussage dieses Papers: DNA-Reparaturprozesse verändern sich während der Embryogenese sehr stark.
Also wissen wir immer noch sehr wenig über die humane Embryogenese. Da wären Genscheren zur Untersuchung sicher nützlich.
Cathomen » Ja, das stimmt. Solche Ansätze, in denen wir den humanen Embryo genetisch verändern und dadurch die weitere Entwicklung beobachten können, sind wissenschaftlich sicherlich interessant. In Deutschland sind diese Ansätze allerdings nicht zugelassen. Von einem therapeutischen Gesichtspunkt her finde ich solche Experimente ohnehin sehr überflüssig, weil wir noch sehr weit davon entfernt sind, solche Eingriffe im Embryo anzuwenden. Außerdem haben wir gute Alternativen.
Zum Beispiel?
Cathomen » Träger einer schweren Erbkrankheit, die trotzdem ein gesundes Kind zur Welt bringen möchten, haben die Möglichkeit ihren Embryo durch Präimplantationsdiagnostik untersuchen zu lassen. Deshalb brauchen wir kein CRISPR/Cas oder andere Genscheren, um das Problem anzugehen.
Und was, wenn die Eltern nicht in der Lage sind, einen gesunden Embryo zu zeugen?
Cathomen » Das kommt in den seltensten Fällen vor, da sowohl bei Erbkrankheiten mit rezessivem als auch dominantem Erbgang eine Präimplantationsdiagnostik die Auswahl von „gesunden“ Embryonen erlaubt. Eine Ausnahme wären zum Beispiel Erbkrankheiten, die über die mitochondriale DNA vererbt werden. Aber in diesen Fällen stößt auch die Genscheren-Technologie an ihre Grenzen, da mitochondriale DNA kaum korrigiert werden kann. Abhilfe könnte hier die Ei-Spende einer gesunden Mutter leisten, allerdings sind die sogenannten Drei-Eltern-Babys ethisch auch umstritten.
Was würden Sie Genome-Editing-Kritikern sagen?
Cathomen » Ich glaube, Genscheren gehören zum medizinischen Fortschritt. In Zukunft werden wir tatsächlich in der Lage sein, Infektionskrankheiten, Krebserkrankungen oder Erbkrankheiten mit CRISPR/Cas und anderen Genscheren therapieren zu können. Wir müssen uns allerdings die Frage stellen, wo wir die Grenze setzen.
Wo setzen Sie Ihre?
Cathomen » Ganz klar in der Verwendung von CRISPR/Cas und anderen Genscheren in humanen Embryonen – davon halte ich sehr wenig. Denn es gibt andere Möglichkeiten, die meines Erachtens besser zum Ziel führen. Der deutsche Gesetzgeber sieht das aktuell genauso, aber vielleicht wird das in Zukunft mal anders sein. In Großbritannien ist das Genome Editing in humanen Embryonen mit dem Argument zulässig, dass wir die Embryogenese so besser studieren können. Das ist eine nachvollziehbare Begründung; trotzdem bin ich mit der deutschen Gesetzgebung sehr zufrieden und kann hervorragend damit leben.
Zur Person
Der gebürtige Schweizer Toni Cathomen studierte Biologie und promovierte an der Universität Zürich. Nach seiner Postdoktorandenzeit am Salk Institute in San Diego, Kalifornien, zog es Cathomen 2003 nach Deutschland – erst an die Charité Berlin, dann zur Medizinischen Hochschule Hannover. Seit 2012 ist Cathomen Professor für Zell- und Gentherapie und Direktor des Instituts für Transfusionsmedizin und Gentherapie des Universitätsklinikums Freiburg.