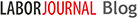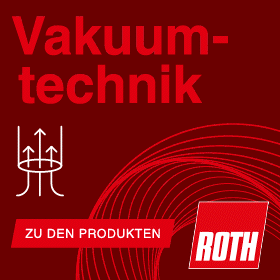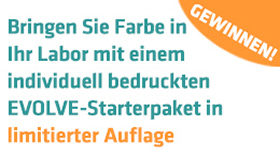Der mysteriöse Geheimrat
Winfried Köppelle
(23.10.2013) Trotz seines populären Namens und seiner cleveren Erfindung ist er der große Unbekannte der deutschen Bakteriologenzunft.
Mal ehrlich: Was sagen Ihnen die Namen Kocher, Kossel und Wagner-Jauregg? Wissen Sie, was Otto Loewi leistete und wer Werner Forßmann war, und was all diese fünf Personen verbindet? Keine Idee?
Macht nichts, dazu kommen wir später. Der Name der gesuchten Person ist schwieriger zu erraten, obwohl Sie ihn regelmäßig benutzen – etwa wenn Sie eine Routinebestellung bei einer Laborzulieferfirma aufgeben. Es ist der Name eines Mikrobiologen und Mediziners, der im Rheinland als Sohn eines Gymnasialprofessors zur Welt kam und 69 Jahre später im ostdeutschen Burgenland starb.
Doch ist dies wirklich so? Der Verfasser dieses Rätsels ist kein Historiker, und er hatte auch keinen Zugang zu zeitgenössischen Originalquellen. Eine Biografie gibt es auch nicht. Daher musste er sich sämtliche Informationen im Internet zusammensuchen, und dabei fiel ihm auf: Über den Gesuchten kursieren Daten, die so nicht stimmen können. Selbst die Fotos, die man ergoogelt, zeigen nicht ihn, sondern einen berühmten Zeitgenossen. Was Sie also im Folgenden lesen, sollten Sie mit Vorsicht genießen. Es könnte fehlerhaft sein.
Als gesichert kann gelten, dass unser Mann Ende des 19. Jahrhunderts in der damaligen Hauptstadt studierte und mit knapp 24 Jahren seine Doktorprüfung ablegte. Danach betreute er wohl für eine Weile uniformierte Pickelhaubenträger, um zwischendurch als Laborant beim prominentesten Biowissenschaftler der damaligen Zeit zu hospitieren. Im Labor dieser Lichtgestalt, am Kaiserlichen Gesundheitsamt zu Berlin, würde man ihm die neuesten technologischen Kniffe schon beibringen: den Umgang mit den famosen Ölimmersions-Linsen etwa, und dieses sensationelle bildgebende Verfahren namens Fotografie.
Zu Gast im berühmtesten Labor Berlins
Doch letztlich war es eher der Gesuchte, der seiner neuen Wirkungsstätte neue Arbeitsmethoden und Gerätschaften spendierte, etwa einen trickreichen Trennfilter sowie Transportgefäße für unappetitliche Laborproben. Ein weiteres Problem wartete schon; es betraf bakterielle Nährmedien. Wie brachte man die in Fleischbrühe gezüchteten Mistviecher dazu, so zu wachsen, dass man sie mühelos auffinden, vereinzeln, aufnehmen und an andere Orte verbringen konnte? Die verwendete Gelatine war reichlich ungeeignet: An warmen Sommertagen verflüssigte sie sich und ruinierte das Experiment, und viele Bakterien fraßen sie und damit ihren Aufbewahrungsort einfach auf.
Während eines Familienpicknicks betrachtete ein Laborkollege versonnen den Pudding seiner Frau und sah die Lösung: ein Galactose-Polymer aus den Zellwänden asiatischer Rotalgen. Mit der daraufhin entwickelten Kulturplatten-Technik mit festen, transparenten Nährböden sollten die Probleme doch ein Ende haben!
Noch nicht ganz; erst musste unserem Gesuchten noch ein cleveres Glasgefäß einfallen. Stapel- und sterilisierbar trat es den Siegeszug durch die mikrobiologischen Labore an und gehört heute, leicht modifiziert, zur Grundausstattung: Zwanzig Stück im sterilen Plastikbeutel kosten 1,50 Euro. Unser Mann wurde später zum geheimen Regierungsrat ernannt, kümmerte sich um Lungensanatoriums-Insassen und ging als 48-jähriger, wohl aus Gesundheitsgründen, in den vorzeitigen Ruhestand. 92 Jahre nach seinem Tod ehrte ihn die Internetplattform Google mit einem animierten „Doodle“.
Um die Frage nach den eingangs erwähnten Namen zu beantworten: Bei diesen handelt es sich um die deutschsprachigen Medizin-Nobelpreisträger der Jahre 1909, 1910, 1927, 1936 und 1956. Auch wenn unser Mann meilenweit von einer derart prestigeträchtigen Auszeichnung entfernt blieb – zumindest sein Name ist bis heute allgegenwärtig. Wie lautet er?
Hier geht es zu einem Artikel zum wahren Antlitz des Geheimrates. Vorsicht: Darin steht auch die Auflösung.
Zur Auflösung klicken
Der gesuchte, mysteriöse Geheimrat ist der deutsche Bakteriologe Julius Richard Petri (1852-1921). Als Mitarbeiter Robert Kochs soll der vormalige Militärarzt Ende des 19. Jahrhunderts (es ist unklar, ob 1877 oder 1887) in Berlin die nach ihm benannte Schale samt Deckel erfunden haben, und dazu auch gleich eine brauchbare Ausplattier- und Vereinzelungstechnik. Nach seiner Zeit bei Koch erlangte Petri leitende Funktionen am kaiserlichen Gesundheitsamt und publizierte zu mikrobiologischen und epidemiologischen Themen. Als Ruheständler soll er stark übergewichtig gewesen und mit Vorliebe in einer Militärarzt-Uniform aufgetreten sein. Nach seinem Tod geriet er in Vergessenheit; offenbar ist von Petri nicht einmal ein Foto überliefert. Internetbilder des Gesuchten zeigen in Wahrheit die Portraits von Koch oder Paul Ehrlich.