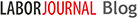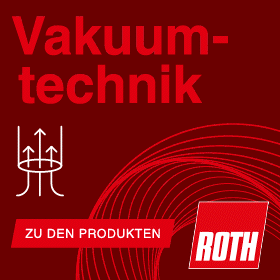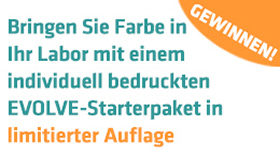Der einfallsreiche Tüftler
Winfried Köppelle
(23.05.2013) Der junge Arzt erfand im Alleingang das seither wohl meistbenutzte Laborgerät, war an dessen Vermarktung uninteressiert und ertrank mit 39 Jahren beim Baden in den oberbayerischen Alpen.
Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie das Wort „Labor“ hören? Weiße Kittel und Schutzbrillen, Zentrifugen und Bunsenbrenner, dazu Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser? Mag sein, doch weit charakteristischer als all diese Gerätschaften ist ein anderes Utensil, dessen ungelenke Benutzung durch Laienhände gelegentlich für Heiterkeit sorgt. Nach dem Erfinder dieses Geräts wird hier gesucht.
Er starb früh, und wer früh stirbt, ist normalerweise bald vergessen. Doch bei ihm, dem unbekannten Jungmediziner aus Marburg, reichte es sogar für zwei umfangreiche Wikipedia-Einträge – einer biografisch, der andere über die von ihm gemachte Erfindung. Die schöpferische Potenz unseres Gesuchten erscheint umso erstaunlicher, als dieser erst im für Mediziner hohen Alter von 32 Jahren promovierte. Danach blieben ihm nur noch wenige Jahre, seine kreativen Einfälle in ausgeklügelte Apparaturen umzusetzen. Doch das konnte er damals natürlich nicht wissen.
Geboren ist unser Mann, dessen Charakter von Zeitgenossen als freundlich-zurückhaltend, aber auch als „streitbar, schwierig und eigenbrötlerisch“ beschrieben wird, in einer ostwestfälischen Hansestadt. Schon als Knabe atmete er in der elterlichen Wohnung die speziellen Düfte von Lötzinn, Eisenstaub und Klebstoff: Sein Vater war Erfinder (etwa eines weit verbreiteten Fahrradschlosses), und der nicht weniger findige Filius sollte ihm nachfolgen.
Erfinderische Verwandtschaft
Zunächst jedoch brach dieser mit der Familientradition und studierte Medizin. Nicht etwa aus Interesse oder weil er als Arzt Patienten behandeln wollte. Nein, der Grund sei, vertraute er einem Kollegen an, schlicht Selbstschutz. In den letzten Kriegsmonaten habe man ihn, den jungen Soldaten, wegen seiner Lungentuberkulose behandelt – und um künftig vor inkompetenten Ärzten sicher zu sein, werde er am besten selbst einer.
Sein Herz jedoch schlug, wie sich bald zeigte, weiterhin für die Ingenieure und Tüftler. Bereits seine Doktorarbeit an der Universität Marburg zeigte denn auch, aus welchem Holz unser Mann geschnitzt war: Keine medizinertypische Dünnbrettbohrerei lieferte er ab, sondern den ausgeklügelten Bauplan für ein Gerät, das vollautomatisch Blutgerinnungszeiten misst.
Was unseren jungen Postdoc danach erwartete, schmeckte ihm gar nicht: Stundenlange, monotone Fließbandarbeit im Labor, noch dazu mit einem Körperteil, das dafür von der Evolution ganz gewiss nicht entwickelt wurde. Recht bald reichte es dem Jungmediziner mit Hang zum Perfektionismus; entnervt hängte er den Laborkittel erst mal an den Haken, kehrte Tage später wieder an seinen Arbeitsplatz zurück und arbeitete weiter, als sei nichts gewesen.
Doch unser Eigenbrötler hatte etwas mitgebracht. Ein wunderliches Konstrukt, zusammengefügt aus einer Glasspritze, einem Kunststoffschlauch und einer Spiralfeder und dazu bestimmt, künftigen Laborarbeitern das Leben zu erleichtern. Dies erkannte auch der Institutschef, der unseren Mann von seinen eigentlichen Aufgaben entband und ihn ermutigte, seinen ersten Prototypen zu optimieren und schließlich unter der Nummer 1090449 patentieren zu lassen. Danach verlor er schlagartig das Interesse und wandte sich anderen ungelösten Problemen zu. Ein weitsichtiger Hamburger Kaufmann erwarb die Lizenzrechte und machte sein Unternehmen mit der Erfindung des hier Gesuchten weltberühmt.
Wie heißt der Mann, der als HiFi-Enthusiast bekannt war, der seine tagesaktuelle Leistungsfähigkeit anhand der Stärke der Luftelektrizität zu ermitteln suchte und der binnen weniger Jahre auch noch einen Fraktionskollektor und ein UV-Spektrometer erfand? Mit nur 39 Jahren verunglückte er beim Baden in Oberbayern.
Zur Auflösung klicken
Der gesuchte, einfallsreiche Tüftler ist der deutsche Mediziner und Erfinder Heinrich Schnitger (1925-1964). Schnitger war ein begnadeter Erfinder, der seinen Lebenssinn darin sah, technische Unzulänglichkeiten im Labor zu beseitigen. Im Frühjahr 1957 entwickelte er zusammen mit der mechanischen Institutswerkstatt an der Uni Marburg die Kolbenhubpipette. Die Firma Eppendorf erwarb Anfang der 1960er Jahre die Exklusivlizenz an Schnitgers Pipetten-Patent, entwickelte sie gemeinsam mit ihm weiter und vermarktete sie als „Marburg-Pipette“. Daneben erfand Schnitger weitere raffinierte Laborgeräte, zum Beispiel während seiner Doktorarbeit 1956 einen Apparat zur automatisierten Bestimmung von Blutgerinnungszeiten. [Der Rätsel-Autor dankt der Schnitger-Biografin Birgit Pfeiffer und Martin Klingenberg für aufschlussreiche Informationen].