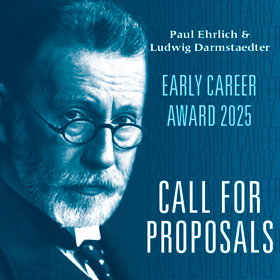Optischer Balanceakt
Produktübersicht: Live-Cell-Imaging-Systeme
Alle Produkte im Überblick 
Maximal scharfe Bilder von gesunden Zellen mit minimaler Beleuchtung − davon träumt der Lebendzell-Mikroskopierer.
Die Lebendzell-Mikroskopie (Live-Cell Imaging) erlebte in den letzten Jahren einen regelrechten Boom, obwohl sie im Grunde schon so alt wie die Mikroskopie selbst ist. Schon zu deren Anfängen untersuchten Forscher intakte Organismen unter dem Mikroskop und versuchten einen Blick in lebende Zellen zu werfen. Dabei wanderten sie stets auf dem schmalen Grat zwischen dem Wohlergehen der untersuchten Zellen und der bestmöglichen Auflösung durch das Mikroskop. Hieran hat sich trotz immer ausgefeilterer und auch neuartiger Mikroskoptechniken bis heute nichts geändert.
Das einfachste und günstigste Instrument für das Live-Cell Imaging ist nach wie vor ein klassisches Weitfeld-Mikroskop. Damit sich die Zellen während des Mikroskopierens wohlfühlen, sind sie in speziellen Petrischalen oder Kammern auf dem Tisch des Mikroskops untergebracht. Mit diesen lassen sich die entscheidenden Wohlfühlparameter der Zellen, etwa die Temperatur, der pH-Wert, der Sauerstoffgehalt sowie die Versorgung mit Nährstoffen und Vitaminen einstellen.
Mikroskopie ist heutzutage gleichbedeutend mit Fluoreszenz-Mikroskopie, das heißt eine Halogen-, Quecksilberdampfoder Leuchtdioden-Lampe beleuchtet die Zellprobe und regt darin enthaltene fluoreszenz- markierte Moleküle zur Fluoreszenzemission an. Das Objektiv sammelt die ausgesandten Fluoreszenz-Signale und leitet sie über das Okular zum Auge des Betrachters beziehungsweise auf die lichtempfindlichen Bauteile einer CCD-Kamera, woraus letztlich ein Bild resultiert.
Äußerst empfindliche CCD-Kameras mit Quantenausbeuten von mehr als 90 Prozent sorgen dafür, dass bereits geringe Anregungsenergien ausreichend starke Fluoreszenz-Signale liefern, wodurch die Strahlenbelastung für die Zellen relativ niedrig gehalten werden kann.
Ein grundlegendes Problem der Weitfeld- Mikroskopie können aber auch immer effizientere CCD-Kameras nicht aus der Welt schaffen: Das für die Beleuchtung der Probe nötige Licht fällt nicht nur auf die Fokusebene, es leuchtet auch Zellareale ober- und unterhalb dieser Ebene aus. Die hieraus entstehenden Fluoreszenz-Emissionen überlagern sich mit den Signalen aus der Fokusebene und verschlechtern hierdurch die Schärfe und Auflösung der resultierenden Bilder.
Superdünn aber mausetot
Bei Zellen, die in einer einzelnen Lage (Monolayer) wachsen, ist dies kein Problem. Will man jedoch eine dickere Probe mikroskopieren oder einen dreidimensionalen Organismus, etwa einen Fischembryo, abbilden, wird die Sache knifflig. In der klassischen Mikroskopie schneidet man die Proben hierzu ganz einfach in hauchdünne Scheiben von wenigen Mikrometern. Da die fixierten Schnitte mausetot sind, ist diese Technik für die Durchführung von Live-Cell Imaging-Experimenten, zum Beispiel Zeitraffer-Aufnahmen von Fischembryos, jedoch nicht geeignet.
Statt die Zell oder Gewebeproben physikalisch in Scheiben zu zerlegen, kann man sie auch optisch mit der Konfokalen Lasermikroskopie (CLSM) in viele kleine Punkte aufteilen, die eine angeschlossene Recheneinheit zu einem Gesamtbild zusammenfügt. So bleiben die Proben zumindest vorläufig am Leben, man handelt sich damit jedoch neue Probleme ein.
Bei der Konfokalen Lasermikroskopie, die mittlerweile Standard in vielen Labors ist, fällt ein Laserstrahl von der Seite (Epi-Fluoreszenz) auf einen dichromatischen Spiegel. Dieser lenkt den Laserstrahl senkrecht nach unten und leitet ihn durch das Objektiv auf die Probe, die Punkt für Punkt gescannt wird.
Wie bei der Weitfeld-Mikroskopie regt der Laserstrahl nicht nur Fluorophore innerhalb der Fokusebene zur Fluoreszenz an, sondern auch darüber und darunter liegende. Das hieraus resultierende Streulicht fängt jedoch eine Lochblende vor dem als Detektor dienenden Photomultiplier ab. Nur Fluoreszenzstrahlen, die von der Fokusebene ausgehen und ein scharfes Bild liefern, können die Blende passieren.
Den Mikroskopierer freut dieser optische Trick, die Zellen unter dem Objektiv dürften von diesem aber weniger begeistert sein. Damit genügend Fluoreszenzlicht durch die winzige Lochblende in den Photomultiplier fällt, muss die Anregungsenergie entsprechend hoch sein. Für die Zellen bedeutet dies, dass sie einem heftigen Photonen-Beschuss ausgesetzt sind, der ihnen insbesondere bei länger dauernden Imaging-Experimenten alles andere als gut tut.
Lochblenden-Karussell
Deutlich senken lässt sich die Licht-Exposition der Zellen mit der Spinning Disc Konfokalen Mikroskopie (SDCM). Hier passiert der Anregungsstrahl zwei sich schnell drehende, parallel übereinander angeordnete Scheiben mit tausenden spiralförmig eingearbeiteten Lochblenden. In den Lochblenden der oberen Scheibe sind kleine Minilinsen untergebracht, die das einfallende Licht verstärken, bevor es durch die Lochblenden der unteren Scheibe hindurch tritt und über das Objektiv auf die Probe fällt. Die schnelle Drehung und die parallel verlaufende Bildaufnahme verkürzen die Aufnahmezeiten und reduzieren hierdurch phototoxische Effekte sowie das Ausbleichen von Fluorophoren.
Tief in die quantenoptische Trickkiste greift die Zweiphotonen- beziehungsweise Multiphotonen-Mikroskopie, mit der sich die Strahlenbelastung beim Live-Cell Imaging weiter minimieren und gleichzeitig die Darstellung von dreidimensionalen Proben verbessern lässt. Ihr Prinzip, das die spätere Nobelpreisträgerin Maria Göppert-Mayer bereits 1931 in ihrer Doktorarbeit zusammenfasste, ist äußerst elegant, die technische Umsetzung gelang aber erst in den neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts.
Vereinte Kräfte
Statt mit einem einzigen Photon aus dem sichtbaren Spektrum des Lichts, werden die Fluoreszenzmoleküle gleichzeitig von zwei (energieärmeren) Infrarot-Photonen vom Grundzustand in den ersten angeregten Zustand angehoben. Infrarot- Photonen dringen nicht nur tiefer in die Probe ein und sind weniger phototoxisch als kurzwellige Photonen. Sie haben noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fluorophor gleichzeitig zwei Photonen absorbiert, ist in der Fokusebene am höchsten, weil hier die größte Photonendichte herrscht. Die Anregung findet deshalb praktisch nur in der Fokusebene statt. Da die Eindringtiefe bis zu einem Millimeter reicht, wird die Zweiphotonen-Mikroskopie häufig für das
In vivo-Imaging von dicken Proben oder lebenden Organismen eingesetzt.
Lichtscheibe
Äußerst clever ist auch die vor zehn Jahren von Ernst Stelzer und Jan Huisken am Heidelberger EMBL ausgetüftelte Lichtscheiben- Mikroskopie (LSM). Statt die Proben physikalisch in Scheiben zu schneiden, beleuchtet man sie bei der LSM mit einer nur wenige Mikrometer dicken Lichtscheibe, die senkrecht zum Detektions-Objektiv orientiert ist und in dessen Fokusebene liegt. Scheibe für Scheibe entsteht so ein dreidimensionales Bild, wobei die Strahlenbelastung der Probe auf die hauchdünne Lichtscheibe begrenzt bleibt.
In Stelzers ursprünglichem Lichtscheiben- Mikroskop erzeugt man die Lichtscheibe mit einer zylindrischen Optik oder einem sich schnell hin und her bewegenden Laserstrahl. Ihre Stärke beträgt etwa einen Mikrometer, was in zellulären Maßstäben gemessen, recht viel ist. Je dicker die Scheibe, desto verschwommener sind die Bilder in der x,y-Ebene und desto schlechter ist die axiale Auflösung entlang der z-Achse.
Kein Wunder also, dass verschiedene Gruppen, unter anderem Stelzers Schüler Andreas Rohrbach vom Institut für Mikrosystemtechnik der Universität Freiburg, fieberhaft an Methoden arbeiten, mit denen sich noch dünnere und kontraststärkere Lichtscheiben herstellen lassen.
Zweiter Geniestreich
Die Nase vorn hat im Moment die Gruppe des frischgekürten Nobelpreisträgers Eric Betzig. Nachdem Betzig, angeregt durch Stelzers Lichtscheiben-Mikroskop, zunächst mit sogenannten Bessel-Strahlen experimentierte, kam er auf den Gedanken, zweidimensionale optische Gitter als Lichtscheiben zu verwenden. Die mit Hilfe von periodischen Interferenzmustern erzeugten Gitter sind nur einige hundert Nanometer dick und erlauben höchstaufgelöste, dreidimensionale Aufnahmen der untersuchten Organismen (Bi-Chang Chen et al., Science 346, (2014); DOI: 10.1126/ science.1257998).
Noch steht Betzigs Gitter-Lichtscheiben- Mikroskop nur in seinem Labor im Janelia Research Campus in Virginia, USA. Die großen Mikroskophersteller dürften sich aber schon jetzt die Finger danach lecken und es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis es in die Riege kommerzieller Live- Cell Imaging-Systeme aufgenommen wird.
Alle Produkte im Überblick 
(Erstveröffentlichung: H. Zähringer, Laborjournal 12/2014, Stand: November 2014, alle Angaben ohne Gewähr)
Letzte Änderungen: 09.12.2014