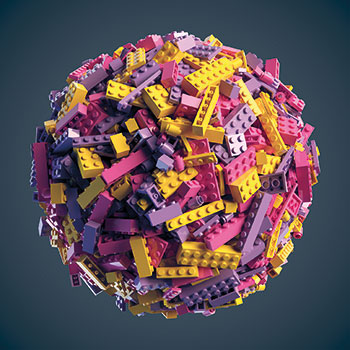Eingeschleust und ausgeholfen
Juliet Merz
In Basel basteln Zellbiologen an synthetischen Organellen und verzeichnen erste Erfolge: Die Vesikel aus Polymeren und Biomolekülen funktionieren auch im Tiermodell. Der nächste Meilenstein scheint nicht mehr fern – eine künstliche Zelle.
Obwohl sie im Vergleich zu Zellen winzig erscheinen und in ihrem Inneren verborgen liegen, sind Zellorganellen in ihrer Komplexität nicht zu unterschätzen. Das wissen auch Cornelia Palivan und ihr Team vom Departement Chemie der Universität Basel. Denn die Schweizer versuchen seit Jahren, ganz in Bottom-up-Manier, Organellen künstlich herzustellen. Jetzt können sie mit Stolz sagen: Sie haben es geschafft.
Erste Erfolge feierte Palivan schon vor fünf Jahren, als es ihr gelang, ein künstliches Peroxisom zu konstruieren und in HeLa-Zellen einzuschleusen (Nano Lett. 13(6): 2875- 83). Im Inneren der synthetischen Organellen fanden dann zwei Reaktionen statt: Das Enzym Cu/Zn-Superoxiddismutase wandelte aggressive Superoxide zu Wasserstoffperoxid um, welches wiederum durch die Lactoperoxidase in Wasser und Sauerstoff gespalten wurde. Das künstliche Peroxisom unterstützte die Zelle also darin, besser mit oxidativem Stress umzugehen.
Ein ähnliches, aber etwas komplexeres System hat nun auch in vivo funktioniert. Anfang dieses Jahres publizierten Palivan und Co. die entsprechenden Ergebnisse in Nature Communications (9: 1127). Gemeinsam mit Jörg Huwyler vom Departement Pharmazeutische Wissenschaften der Uni Basel gelang es ihnen, ihre künstlichen Organellen auch in Zebrafisch-Embryonen einzuschleusen. Mit Mitteln des Swiss Nanoscience Institute (SNI), Schweizerischen Nationalfonds (SNF) und National Centre of Competence in Research (NCCR) – Molecular Systems Engineering konnte das Projekt schließlich verwirklicht werden. „Die Zebrafisch-Embryonen eignen sich besonders für solche Experimente, da sie transparent sind und wir so mittels Licht- und Fluoreszenzmikroskopie alle Veränderungen im Inneren mitverfolgen können“, meint Erstautor Tomaž Einfalt, ehemaliger Doktorand in Palivans Arbeitsgruppe und jetzt Postdoktorand bei Huwyler.
Um die Organellen in die Zebrafisch-Zellen zu bekommen, injizierten die Zellbiologen den Embryonen zunächst intravenös eine Lösung mit den winzigen Polymer-Vesikeln. Das Problem bei der Sache: „Die Polymer-Bläschen allein sind inert – dass heißt, sie interagieren weder mit der Zelle noch irgendwelchen Zellbestandteilen“, erklärt Einfalt. Dennoch schafften es die Vesikel, in die Makrophagen zu gelangen. „Makrophagen sind dafür bekannt, weiche Nanoobjekte aufzunehmen, die kleiner sind als 150 Nanometer – sogar wenn keine Targeting-Moleküle vorhanden sind“, weiß Palivan. Einfalt könnte sich allerdings noch einen weiteren Grund vorstellen: „Die Aufnahme der Vesikel durch die Immunzelle wird vermutlich dadurch unterstützt, dass wir die synthetischen Organellen nicht unter komplett sterilen Bedingungen vorbereiten. Das hat überwiegend praktische Gründe, weil die Herstellung der Vesikel ohnehin sehr zeit- und arbeitsintensiv ist.“
Dennoch mussten die Schweizer ein anderes Hindernis überwinden: „Die Membran der Organellen ist für Moleküle nahezu undurchlässig“, erläutert Einfalt. Damit Substrate und Produkte aus dem Polymer-Bläschen für eine Reaktion ein- beziehungsweise wieder austreten können, mussten Palivan, Einfalt und Co. ein bioaktives Molekül in die Vesikelmembran einbauen. Die Entscheidung fiel auf ein chemisch und genetisch modifiziertes bakterielles Porin namens OmpF (von Outer Membrane Protein F) – das quasi als Schleuse dient.
Das Grundgerüst der künstlichen Vesikel besteht aus einem Copolymer, das sich aus den beiden amphiphilen Polymeren Poly(2-Methyloxazoline) (PMOXA) und Polydimethylsiloxane (PDMS) zusammensetzt. Das als Schleuse dienende, bakterielle Porin öffnet und schließt sich in Abhängigkeit der Glutathion-Konzentration in der Zelle. So können Substanzen die Polymermembran passieren und nach Beendigung der Reaktion das Vesikel wieder verlassen. „Der externe Stimulus, der die Schleuse öffnet, muss aber nicht unbedingt Glutathion sein“, ergänzt Einfalt. „Wir können auch andere Membranproteine einbauen, sodass das Eintreten der Stoffe von anderen Faktoren abhängig sein kann, wie beispielsweise dem pH-Wert.“
Das macht die künstlichen Organellen vor allem für die therapeutische Anwendung interessant. Als Zell-Implantate könnten die Polymer-Vesikel beispielsweise pharmazeutische Wirkstoffe direkt in der Zelle produzieren oder dort freisetzen. „Wir können die Vesikel auch so programmieren, dass sie nur funktionieren, wenn bestimmte Faktoren oder Symptome in der Zelle auftreten, zum Beispiel wenn ein Tumor beginnt zu wachsen“, verrät Einfalt. Sollten pathologische Symptome nicht auftreten, verbleiben die Vesikel im Schlummermodus.
Spontane Blasenbildung
Doch die Herstellung der Organellen ist je nach Polymer und einzubauendem Biomolekül äußerst divers und mitunter komplex. Die von Palivan, Einfalt et al. verwendeten Organellen sind glücklicherweise relativ simpel zusammenzubauen. Die Schweizer streichen dafür das Copolymer dünn auf eine Glasoberfläche eines Rundkolbens aus, lassen es trocknen und geben dann die Enzymlösung direkt dazu. Durch den amphiphilen Charakter der Polymere bilden sich spontan unterschiedlich große Polymer-Bläschen. „Die Vesikelbildung ist für das Polymer thermodynamisch am günstigsten“, meint Einfalt. Die unterschiedlich großen Polymer-Bläschen müssen dann nur noch durch einen Filter gedrückt werden, sodass nahezu gleich große Vesikel dabei herauskommen. „Aktuell produzieren wir mit dieser Technik Organellen mit einem Durchmesser um die hundert Nanometer“, so Einfalt. „Unsere kleinsten Polymer-Bläschen können aber auch dreißig bis vierzig Nanometer klein sein.“ Um größere Polymer-Vesikel zu generieren, ist eine Elektrospannung notwendig. „Dann können wir Vesikel im Mikrometer-Bereich herstellen“, erklärt Einfalt und ergänzt: „Das spielt gerade im Bezug auf künstliche Zellen eine große Rolle.“ Aber dazu später mehr. Doch welchen Nutzen können die Organellen für den Organismus haben?
Der Polymer-Porsche
Wie in dem Versuch vor fünf Jahren kompensieren auch dieses Mal die Organellen den oxidativen Stress der Zelle. Der ausschlaggebende Part passiert indes im Inneren der Organellen. Denn Makrophagen produzieren eine große Menge an Wasserstoffperoxid, das abgebaut werden muss – sonst kommt es zu oxidativen Schäden. Im Versuch der Schweizer konnte das Wasserstoffperoxid durch die bakteriellen Porin-Schleusen in die Organellen gelangen und dort durch eine pflanzliche Peroxidase aus dem Meerrettich in Wasser und Sauerstoff gespalten werden. Da das Porin bidirektional Moleküle passieren lässt, können die Endprodukte das Organell einfach durch das Membranprotein wieder verlassen.
„Sie müssen sich das System wie ein Auto vorstellen“, versinnbildlicht Einfalt. „Dabei ist das Polymer-Vesikel die Karrosserie, das Peroxidase-Enzym der Motor und das bakterielle Porin sowohl das Tankloch als auch der Auspuff. Wasserstoffperoxid wäre in dieser Analogie der Sprit, Wasser und Sauerstoff entsprächen den Abgasen.“
Die künstlichen Organellen bieten zwar viele Möglichkeiten, doch bevor sie es in die Klinik schaffen, stehen noch ein paar Punkte auf der Agenda der Schweizer. So können Palivan und ihr Team beispielsweise noch nicht abschätzen, wie sich die Polymer-Bläschen auf lange Zeit im Organismus verhalten. „Wir wissen zwar, dass die Zelle die Organellen abbaut, aber wie lange das dauert, können wir noch nicht sagen“, gibt Einfalt zu. „Dafür haben wir jetzt eine Langzeitstudie gestartet.“
Außerdem tüfteln die Basler noch daran, wie sie die Vesikel auch in andere Zellen hinein manövrieren können. „Makrophagen eignen sich für die Aufnahme der Organellen selbstverständlich hervorragend, da sie von Natur aus Fremdkörper fressen“, räumt Einfalt ein. Um andere Zellen wie Neurone oder Muskelzellen davon zu überzeugen, die Polymer-Bläschen aufzunehmen, müssten die Zellbiologen tiefer in die Trickkiste greifen: „Wir könnten die Vesikel mit zellulären Signalpeptiden tarnen, sodass diese an die Zellen andocken und von ihr bereitwillig internalisiert werden“, so Einfalt. Das Projekt dazu läuft schon, steht allerdings noch unter Verschluss.
Aber da war doch noch was mit künstlichen Zellen... „Unser nächstes Ziel ist es, eine voll funktionsfähige künstliche Zelle zu entwickeln, die in einem Tiermodell als ein Zell-Imitat existieren und funktionieren kann“, offenbart Einfalt. Dieses Mikrokompartment hätte dann sogar einen eigenen Metabolismus. Das Problem bei den gängigen Versuchen, eine künstliche Zelle zu erschaffen, sei laut Einfalt, dass nach wie vor die Vielfalt der natürlichen Zellbaustoffe fehle. Die eingesetzten Biomoleküle und Materialien reichen demnach nicht aus, um die Komplexität einer Zelle richtig darzustellen. Palivan versucht mit ihren Kollegen, dieses Problem derweil zu lösen. Wie? Auch da hüllen sich die Basler in Schweigen.
Was die Schweizer jedoch verraten können: Eine Technologie, die sie zur Herstellung der künstlichen Zellen verwenden, haben sie bereits patentiert. Von der Universität Basel aus versuchen die Zellbiologen deshalb gerade, ein Start-up zu gründen. „Aber mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen“, meint Einfalt und schmunzelt. Die Zukunft wird zeigen, ob es klappt.
Letzte Änderungen: 08.05.2018