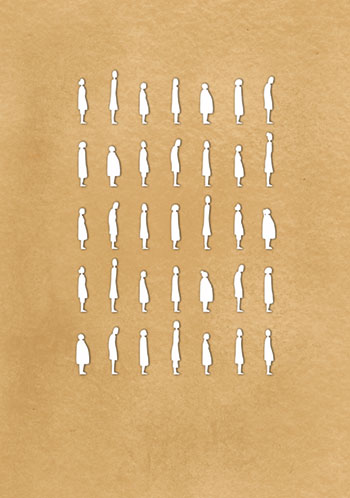Klinische Studien - Ganz mies!
Karin Hollricher
(10.12.2021) „Mangelhaft“ urteilte der gar nicht so verrückte „Wissenschaftsnarr“ Ulrich Dirnagl in Laborjournal 9/2021 (Seite 26-7 - LINK) über die universitären und Industrie-unabhängigen klinischen Studien in Deutschland. Das sagen Forscherinnen und Förderer schon seit Jahrzehnten. Und was sind die Konsequenzen?
Anlass für Dirnagls vernichtende Bewertung war die Veröffentlichung einer systematischen Analyse klinischer Studien zu COVID-19 in Deutschland. Trotz der offensichtlichen Notwendigkeit, wirksame Therapeutika gegen die Infektionskrankheit zu finden, wurde nur jeder hundertste in Deutschland hospitalisierte COVID-19-Patient in eine randomisierte klinische Studie eingeschlossen. Nur wenige der klinischen Studien in Deutschland wurden bis zum Stichtag im April 2021 auch tatsächlich abgeschlossen. Die Mehrzahl erreichte nicht die vorgesehenen Teilnehmerzahlen oder wurde gar abgebrochen.
Das war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht ein Charakteristikum nur deutscher Studien, weltweit sah es ähnlich aus: Dreißig Prozent der COVID-19-Studien, die in den ersten einhundert Tagen der Pandemie begonnen hatten, hatten noch nicht einmal Probanden rekrutiert. Nur zehn Prozent hatten bis Mitte Oktober Resultate veröffentlicht, so das Ergebnis einer Analyse (JAMA Netw. Open 4(3): e210330).
Spitzenreiter USA
Aktuelle Daten zu COVID-19-Studien in Deutschland findet man auf einer Weltkarte des Instituts für Klinische Forschung der Universität Basel (COVID-evidence.org/database). Am 15. November 2021 ist Deutschland auf der Karte hellgrün eingefärbt, was mit 122 bis 241 Studien der zweitniedrigsten Kategorie entspricht. Ein Klick auf das Land spezifiziert: 202 Studien mit insgesamt 522.528 geplanten Teilnehmern, davon 122 internationale Studien. Zum Vergleich: Das Vereinigte Königreich fällt in die nächsthöhere Kategorie mit 261 Studien und knapp einer Million geplanten Probanden. Spitzenreiter sind die USA mit 842 Studien, davon 270 mit internationaler Beteiligung, mit über 21 Millionen geplanten Studienteilnehmern. Jörg Meerpohl, Direktor des Instituts für Evidenz in der Medizin der Universität Freiburg sowie Direktor von Cochrane Deutschland, konstatiert: „Es ist ernüchternd zu sehen, dass es Deutschland nicht in größerem Umfang gelungen ist, wichtige klinische Studien zu COVID-19 durchzuführen beziehungsweise diese wie geplant abzuschließen.“
Die betreffenden Analysen verantworten Lars Hemkens und Perrine Janiaud des Basler Instituts und ihre Kollegen. Das Paper zu deutschen Studien ist noch im Peer-Review-Verfahren (f1000research.com/articles/10-913). Wie die Forscher schreiben, hat das Paper zwar einige Limitationen. Dazu gehört jedoch nicht, was Oliver Cornely bemängelte: Der Leiter des Wissenschaftlichen Zentrums für Klinische Studien in Köln hält allein die Anzahl der klinischen Prüfungen für kein vernünftiges Bewertungsmaß. Es sei wichtiger, zu fragen, welche Studien Ergebnisse gebracht hätten, die die Behandlung verbesserten.
Kritik an dem Paper ändert allerdings nichts an dem seit langem bekannten Kernproblem: Die klinische Forschung in Deutschland ist ausbaufähig, nicht nur hinsichtlich COVID-19-Studien. Beispiel Onkologie: Bei der Prüfung von Krebstherapeutika sei Deutschland in den vergangenen Jahren von Platz eins in der Welt auf Platz vier zurückgefallen, kritisierte der Direktor des Centrums für Integrierte Onkologie (CIO) und Direktor der Klinik für Innere Medizin der Universität Köln, Michael Hallek, auf der „Vision Zero“-Konferenz, die im Juni in Berlin stattfand.
„Das Potenzial zur Durchführung hochrelevanter klinischer Studien, die aus der Universitätsmedizin heraus initiiert werden, ist in Deutschland grundsätzlich sehr hoch – wie auch die Nachfrage im Programm „Klinische Studien“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zeigt –, aber es ist bei weitem nicht ausgeschöpft“, urteilt Britta Sigmund, Direktorin der Klinik für Gastroenterologie und Infektiologie an der Charité Berlin und Vizepräsidentin der DFG. Das alles ist nicht neu. Seit zig Jahren erheben forschende Kliniker, DFG und Wissenschaftsrat immer und immer wieder ihre kritischen Stimmen.
Schon 1986 beurteilte der Wissenschaftsrat in seinen „Empfehlungen zur klinischen Forschung in den Hochschulen“, „[…] dass der Leistungsstand der klinischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland trotz der zahlreichen Vorschläge und Bemühungen zu seiner Verbesserung – und unbeschadet mancher hervorragender Einzelergebnisse – insgesamt unbefriedigend ist“. Der Wissenschaftsrat schlug vor: Verbesserung der medizinischen Ausbildung und angemessene Entfaltungsmöglichkeiten für den klinisch-wissenschaftlichen Nachwuchs, mehr Zusammenarbeit der beteiligten Kliniken und Einrichtungen, Anpassung der Hochschulstrukturen an die wissenschaftliche Entwicklung der Medizin. Diese Empfehlungen sind heute so aktuell wie damals.
Nicht ausgeschöpftes Potenzial
1999 veröffentlichte die DFG eine Denkschrift „Zur Lage der klinischen Forschung“. Deren geistiger – und über die Zustände offensichtlich verzweifelter – Vater ist Johannes Dichgans, damals DFG-Vizepräsident und Leiter der Neurologischen Uniklinik Tübingen. „Diese schonungslose Analyse ließ keinen Zweifel daran, dass die klinische Forschung in Deutschland einen tiefgehenden Strukturwandel brauchte“, sagte Dichgans in diesem Oktober in einem Rückblick auf die Gründung des Zentrums für Neurologie in Tübingen, das er vor zwanzig Jahren mithilfe der Hertie-Stiftung anschob, um den nötigen Strukturwandel wenigstens in Tübingen in die Wege zu leiten. „Unterschätzt hatte ich allerdings die Widerstände, die dieses Angebot in den Reihen der Medizinischen Fakultät auslöste. Viele Kolleginnen und Kollegen befürchteten damals, dass das geplante Zentrum für Neurologie die Balance zwischen den Fächern verschieben würde und eine höhere Grundausstattung zu Lasten der anderen Fächer einfordern könnte. Deshalb stand das Projekt mehrmals auf der Kippe.“ Das Zentrum wurde dann doch gegründet und gilt heute als Vorbild für die Umsetzung klinisch-wissenschaftlicher Weiterbildung und Forschung.
In den vergangenen sechs Jahren veröffentlichte die DFG etliche Stellungnahmen, Impulspapiere oder Empfehlungen zum Thema. In der DFG-Stellungnahme von 2018 steht etwa: „Rezente Analysen zeigen, dass die Leistungsfähigkeit Deutschlands in bestimmten Feldern klinischer Studien und im internationalen Vergleich derzeit nicht den Erwartungen Deutschlands als führende Wissenschaftsnation entspricht.“ Im selben Jahr monierte der Wissenschaftsrat in seiner Analyse: „Das Potenzial ‚nichtkommerzieller’ oder ‚wissenschaftsgetriebener’ klinischer Studien ist nicht ausgeschöpft.“ Das Gremium kommt zu der Einschätzung, dass „gemessen an einer leitenden Rolle bei herausragend publizierten klinischen Studien die deutsche Forschung im Vergleich mit wichtigen Referenzländern keine internationale Spitzenposition ein[nimmt]“.
Ähnlich sieht die Situation auch bei klinischen Prüfungen aus, die von der Industrie unterstützt werden. Der Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (vfa) zählte 641 klinische Prüfungen für das Jahr 2016 – drei Jahre später sind es nur noch 550. Damit ist Deutschland hinter Spanien zurückgefallen.
Natürlich wurden viele Vorschläge zur Behebung der gravierendsten Hindernisse entwickelt. Und hier und da wurde man sogar aktiv. So finanziert die DFG inzwischen dauerhaft ein Förderprogramm „Klinische Studien“, in dessen Rahmen sie interventionelle klinische Studien bis Phase 2, aber auch Beobachtungs- und Machbarkeitsstudien unterstützt. Ein Tropfen auf den heißen Stein, der der im DFG-Impulspapier 2017 beklagten zunehmenden Einengung der Universitätsmedizin auf die Ökonomie eines Maximalversorgers nicht Einhalt gebieten kann und damit die Ausbildung und Motivation des Nachwuchses erschwert oder blockiert.
Inkonsequent und unvollständig
„Natürlich wäre mehr Geld für die klinische Forschung prima, doch damit alleine ist es leider nicht getan. Denn die Probleme sind vielfältig“, so Cochrane-Deutschland-Direktor Meerpohl. „Es fängt schon bei der Planung und Registrierung an – und hört bei der unvollständigen oder nicht existenten Veröffentlichung von Daten auf.“
Eine Studie muss zum einen nicht unbedingt registriert werden und kann zum anderen – wenn doch – in einem von mehreren Registern gemeldet werden. Wenn man Studien aber nicht einfach findet, können sowohl wissenschaftliche Lücken wie auch Redundanz entstehen. Könnte man nicht einfach ein weltweit gültiges Register führen? „Ein solches Register müsste unabhängig von politischen Einflüssen und Stimmungen nachhaltig finanziert sein“, sagt Meerpohl. „Das ist beispielsweise das clinicaltrials.gov nicht. Daher wäre vielleicht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die richtige Organisation, der man ein solches Register anvertrauen könnte. Allerdings gibt es durchaus unterschiedliche Sichtweisen darüber, welche Studien überhaupt und bis zu welcher Detailtiefe Informationen in ein solches Register hineingehören.“ Okay, ganz so einfach scheint nicht einmal dieses vermeintlich so simple Problem zu sein.
Klinische Forschung erweckt für Mediziner und Molekularbiologinnen auch nicht den Eindruck, besonders attraktiv zu sein. Meerpohl: „Hinter den angesehenen experimentellen Doktorarbeiten in der Medizin verbergen sich in der Regel Laborarbeiten, selten klinische Studien. In Gesprächen mit internationalen Kollegen merke ich, dass die klinische Forschung in anderen Ländern ein höheres Ansehen hat und attraktiver ist als in Deutschland.“ Es gibt ja auch keine entsprechenden Qualifikationen wie Facharzt oder Weiterbildungen für klinische Epidemiologie. „Also fehlt vielfach auch die Methodenkompetenz“, so Meerpohl.
Ein weiteres Problem entsteht durch das akademische Belohnungssystem: der persönlichen Publikationsliste. Eine Studie an Zellkulturen liefert meist schneller publizierbare Daten als eine große klinische Studie mit Patienten. Meerpohl: „Außerdem fehlt es zum Teil an Bereitschaft und Offenheit der Zentren, kooperativ große multizentrische Studien durchzuführen. Auch weil eine kleine Studie einfacher ist. Sie ist zwar weniger aussagekräftig, aber schneller durchzuführen und zu publizieren.“ Man könnte die Publikation der Ergebnisse einer klinischen Studie einfach höher bewerten als eine In-vitro-Studie. Und man könnte auch einer randomisierten, multizentrischen Studie, deren Ergebnis schließlich tatsächlich Einfluss auf die Therapie und Versorgung von Patienten nimmt, entsprechend höher würdigen als eine kleine, nicht randomisierte, monozentrische Studie oder ein Laborexperiment. Warum tut man das eigentlich nicht?
Ganz besonders beklagt wird die hiesige überbordende Regulationswut. Der Kölner Leiter des Wissenschaftlichen Zentrums für Klinische Studien, Oliver Cornely, beschreibt das anhand zweier Beispiele: „Sie möchten bei 75-Jährigen in einer randomisierten Studie prüfen, ob der mRNA-Impfstoff von BioNTech oder der von Moderna die bessere Immunantwort hervorruft. Die Aufklärungsunterlagen umfassen 42 Seiten. Keine Kürzung möglich, wenn man allen Vorschriften genügen will. Ein weiteres Beispiel: Sie möchten die Antikörperantwort bei 200 Personen bestimmen, die nach dem AstraZeneca-Vakzin gemäß der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) als zweite Impfung BioNTech erhalten. In Deutschland ist das eine klinische Studie, das bedeutet viele Dokumente erstellen und zur Genehmigung einreichen. In weiten Teilen Europas ist das nicht so. Das ist aber sehr schwierig, da es für jedes Hindernis immer gute Begründungen gibt. Zum Beispiel muss das Arzneimittelgesetz geändert werden, das wird nicht rasch gehen.“
Han Steutel, Präsident des vfa, sieht in Zuverlässigkeit und Kompetenz des medizinischen Personals gute Gründe dafür, auch weiterhin Deutschland in klinische Prüfungen mit einzubeziehen. „Aber einige andere Länder bieten in vielerlei Hinsicht bessere Bedingungen für klinische Studien. Spanien beispielsweise: Die Genehmigungsverfahren erhielten enge Zeitvorgaben, und für die Zusammenarbeit von Firmen mit spanischen Kliniken oder Arztpraxen ist ein Mustervertrag verbindlich, der nur an die Spezifika der jeweiligen Studie angepasst werden muss. So punktet das Land bei der Geschwindigkeit der Studienvorbereitung. Außerdem haben spanische Kliniken die Studiendurchführung besser in ihre Prozesse integriert, und es gibt mehr Personal.“
Bürokratie-Dschungel
Musterverträge sind in Deutschland nicht etabliert. Es gibt zwar Mustervertragsklauseln, doch sie sind nicht verbindlich. Und auch wenn man sie benutzt, muss man mit jeder beteiligten Klinik eigene Verträge abschließen. Im krassen Gegensatz dazu Großbritannien: Hier führt der National Health Service zentralisiert die Verhandlungen anhand einheitlicher Regeln. Das spart viel Zeit und Arbeit.
Aber nicht nur Bundesverordnungen bremsen, auch das föderale System trägt sein Scherflein zur Lage bei. Für eine multizentrische Studie muss man den Vorgaben des Datenschutzes in allen beteiligten Bundesländern genügen. Leider aber interpretiert jeder Landes-Datenschützer die Regeln auf seine Weise. Dazu sagt vfa-Präsident Steutel: „Studiendaten unterliegen dem Datenschutz, und das ist gut so. Aber Deutschland hat dafür so viele Auslegungen, wie es Landes-Datenschutzbehörden gibt. Hier wird dringend eine bundesweite Vereinheitlichung gebraucht, da Prüfungen ja meist in medizinischen Studieneinrichtungen mehrerer Bundesländer laufen sollen. Datenintegration ist sehr relevant und wird immer wichtiger.“
Und er fügt hinzu: „Für unsere Unternehmen spielt aber Geschwindigkeit die noch größere Rolle – und ausgerechnet sie ist Deutschlands größtes Manko. In der Zeit, die man hierzulande braucht, um alle Genehmigungen einzuholen und die Verträge mit den Kliniken zu verhandeln, werden oft in anderen Ländern bereits alle nötigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Studie rekrutiert und behandelt. Die Vorbereitung der deutschen Mitwirkung an der Studie war dann leider ein Investment ohne Return. Hier könnte Deutschland von Spanien lernen: Musterverträge oder zumindest Mustervertragsklauseln als Verhandlungsgrundlage, mehr Studienpersonal an Kliniken – das sind Lösungen, wie wir sie brauchen!“ Unbedingt brauchen – wie Cornely an seinem Impfstoffe-Beispiel belegt: „Von den 42 Seiten im obigen Beispiel widmen sich elf dem Datenschutz. Die Erklärung des Wesens der Studie passt hingegen auf eine Postkarte.“ Da ist wirklich etwas aus der Balance geraten.
Manches wird sich 2022 mit Inkrafttreten der neuen EU-Verordnung für Genehmigungsverfahren zu klinischen Prüfungen verbessern, die dann auch in Deutschland greifen. Beispielsweise müsste man dann in das Verfahren nicht mehr jede Ethikkommission jeder beteiligten Klinik einbeziehen, sondern nur noch eine. Allerdings weiß der Antragsteller nicht, welche Kommission für sein Vorhaben zuständig sein wird – und das ist deshalb zumindest „anstrengend“, weil die Kommissionen durchaus unterschiedliche Schwerpunkte und Vorstellungen haben bei Themen wie beispielsweise „Entnahme von biologischem Material“ oder „Umsetzung des Datenschutzes“. Von einer deutschlandweiten Vereinheitlichung der Anforderungen ist man anscheinend weit entfernt.
Heiße Luft?
Angesichts dieser langjährigen und umfassenden Kritik ist es ja schön, dass nun – unter dem Eindruck der Corona-Ereignisse – tatsächlich Veränderungen am Start sind. So fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) den Aufbau des Forschungsnetzwerks Universitätsmedizin mit 240 Millionen Euro bis zum Jahr 2024, „um die Forschungsaktivitäten der deutschen Universitätsmedizin zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie zu stärken”, wie es auf der Website des Netzwerks heißt.
Insgesamt 13 Forschungsprojekte werden in diesem Rahmen finanziert, vom Notaufnahmeregister AKTIN, dem Evidenznetzwerk CEO-sys und Corona-Apps bis zu COVIM zur Untersuchung der SARS-CoV-2-Immunität in der Bevölkerung. FoDaPla kümmert sich um eine bundesweite datenschutzkonforme Infrastruktur für die Speicherung von COVID-19-Forschungsdaten. Allerdings fragt man sich, warum die Politik erst jetzt und nur für COVID-19-Forschung Strukturen ändert und Geld lockermacht.
Dringend nötig wäre es vielmehr, endlich die vielfach vorgedachten Reformen in den klinischen Strukturen, der wissenschaftlichen Ausbildung, dem Datenschutz und der Verwaltung umzusetzen, damit die klinische Forschung auch in Deutschland (wieder) florieren kann.