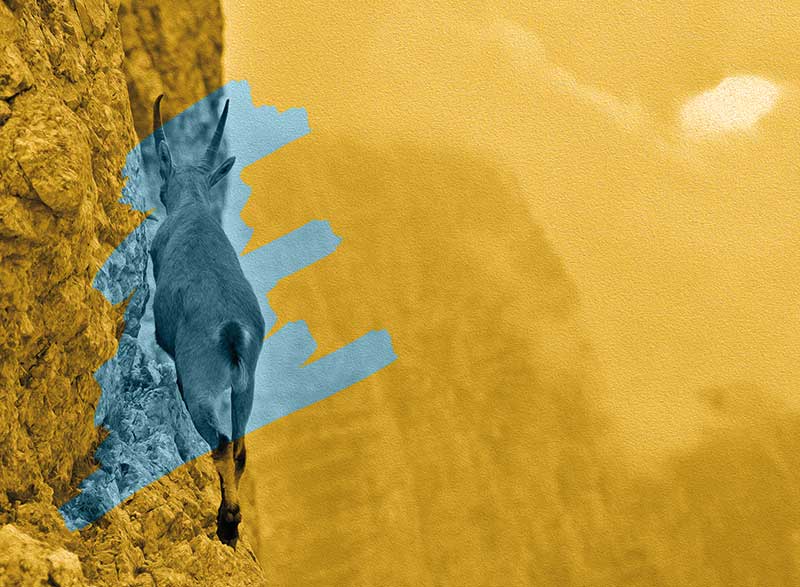Die Nordwestpassage
Von Claus Kremoser, Heidelberg
(07.07.2020) Gibt es einen dritten Karriereweg für Wissenschaftler zwischen Akademia und Industrieforschung?
Nun, bei mir liegt die Zeit der Entscheidung, welchen Weg ich nach wissenschaftlicher Ausbildung und Promotion einschlagen sollte, schon etwas länger zurück. Aber ich denke, dass es genügend Leser dieser Zeitschrift gibt, die sich gerade genau in dieser Situation befinden – an dem Scheideweg, welchen beruflichen Weg sie nach der langen und anstrengenden Ausbildung nehmen sollen.
Jetzt könnte man einfach aufzählen, welche Wege es denn gibt und welche persönlichen Randbedingungen man sich selbst setzen will. Wenn man dann die entsprechenden Vor- und Nachteile auflistet und vergleicht, müsste man für sich selbst zu einer Zielfindung kommen, wohin man eigentlich will.
Aber ist es so einfach? Es gibt dutzende anderer Faktoren, die in offiziellen Karriereberatungen nicht auftauchen, aber die am Ende doch über das eigene Schicksal entscheiden. Wie zum Beispiel: Wo wohnt der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin, welchen Job sucht er oder sie? Will ich eher in die Ferne schweifen oder gefällt es mir in der alten Heimat oder am Studienort doch ganz gut? Wer bietet mir denn was an? Kenne ich irgendwo Leute, die mir vor Ort den Einstieg in den Beruf ermöglichen? Oder für die akademische Karriere: Habe ich genügend Fürsprecher, die mir den Einstieg zumindest am Anfang erleichtern?
Neben diesen praktischen Faktoren gibt es bei vielen Menschen (zumindest bei mir) noch etwas anderes, eine Motivation, die, wenn sie verspürt wird, die stärkste alle Kräfte in dieser „Vektoraddition“ der verschiedensten Einflussfaktoren ist. Man kann es gar nicht so leicht in Worte fassen, was es ist; sicher ist es was anderes als „ganz viel Geld verdienen“ oder „ganz viel publizieren und berühmter Professor werden“ oder einfach nur „einen stabilen Job mit sicherem Auskommen ohne viel Stress haben“. Die Gemütlichen, die einfach nur einen Job haben wollen, sollten hier nicht mehr weiterlesen, sie werden es vermutlich nicht verstehen.
Diese höheren Motivationsfaktoren, von denen ich spreche, lassen sich vielleicht am besten in Bildern erfassen. Nehmen wir mal an, wir würden 100 frei aus der Bevölkerung ausgewählte Leute in ein Tal stellen, mit dem Ziel, die weit höher gelegene Berghütte zu erreichen. Zur Auswahl stehen: a) der Sessellift für die Faulen, b) der Schotter-Wanderweg für die, die sich bewegen, aber kein Risiko eingehen wollen und c) die Kletterroute, die am steilsten und anstrengendsten ist, dafür aber die besten Aussichten und das größte Erfolgserlebnis bietet. Ich würde mal schätzen, dass bei einer reinen Zufallsauswahl die Verteilung auf a) : b) : c) wohl so bei 70 : 25 : 5 liegen würde. Die meisten Menschen sind halt faul und die, die es nicht sind, sind zumindest größtenteils risikoavers.
Ich hätte gedacht, dass diese Verteilung auch ungefähr der Verteilung der Promovierten in den Fächern Biologie, Biochemie oder Chemie auf die späteren Berufsfelder entspricht – wie Beschäftigung in der Wirtschaft (a), akademische Laufbahn (b) und Selbstständigkeit oder Unternehmertum (c). Aber tatsächlich ist der Anteil in der Industrie relativ niedrig (je nach Studienrichtung bei circa dreißig bis vierzig Prozent) und der in staatlichen Stellen, Behörden, Gesundheitsämtern und so weiter relativ hoch, wobei auf die wirklich akademische Forschung an Universitäten und Instituten nur ein recht geringer Teil von circa zwanzig Prozent entfällt. Was in Deutschland leider nur einen kleinen Teil ausmacht, sind die Jobs in kleinen und mittleren Unternehmen, in unserem Fall also in jungen Biotechfirmen, die in den USA sowohl einen großen Teil der Dynamik in der Medikamentenentwicklung als auch als Arbeitgeber für hochqualifizierte Absolventen ausmachen. Warum leider? Sind denn Universitäten oder etablierte große Pharma- und Chemieunternehmen die schlechteren Arbeitgeber? Gerade die Coronakrise hat doch gezeigt, dass die kleinen Firmen und insbesondere Start-ups besonders vulnerabel sind. Ist es da nicht sinnvoll, sich den Staat oder Unternehmen wie BASF, Bayer, Merck et al. als Arbeitgeber auszusuchen? Was spricht denn gegen ein geordnetes Arbeitsumfeld und ein gutes, berechenbares Einkommen im Fall eines großen Industrieunternehmens oder gegen die Freiheit und gleichzeitige Sicherheit der Universitätsprofessur, so sie denn erst einmal erreicht wurde?
Nun, im Fall der akademischen Forschung kann man natürlich einiges einwenden. Die Klassiker, die gegen den „Kletterroutenweg“ zur Professur sprechen, wären: Der Weg ist unberechenbar; man muss Glück haben, die richtige Umgebung und das richtige Thema zu finden; Publikationen und ihre Metrik sind alles, wenn überhaupt, dann zählen noch persönliche Kontakte; der Weg ist lang und mit vielen Ortswechseln verbunden; und so weiter.
Für mich der größte Nachteil dieses Weges hin zu Professur ist aber mittlerweile die fehlende Positivmotivation. Wenn das Ziel einer W2/W3-Stelle erreicht wurde, was ist dann? Kann ich mir anschließend wirklich meinen Forschungsschwerpunkt auswählen oder muss ich die aktuellen Modethemen bedienen, die sich in den Grant-Programmen wiederfinden? Wird mir nicht durch meine Drittmittel-Forschungsförderung größtenteils vorgegeben, was ich machen soll? Könnte ich mich wirklich einem neuen, ganz grundsätzlichen Thema widmen, ohne dass es in ein bis zwei Jahren gleich Paper hervorbringen muss?
Ich fürchte nein. Getrieben von der Jagd auf den Hirsch(faktor) hat der Arbeitsgruppenleiter hauptsächlich eines im Sinn: Welche Experimente ziehe ich durch, damit ich möglichst schnell Paper daraus machen kann? Gerne setzt man dazu moderne bildliefernde Verfahren ein, denn je fancier die eingesetzte Methode, je teurer das dafür benötigte Gerät, je bunter die Abbildungen, desto höher am Ende der Impact Factor des Journals, in dem die Arbeit landen kann.
Ist das das Ziel des beruflichen Lebens? Da ist die andere Alternative der 40-Stunden-Job in dem Großunternehmen – doch die ehrlichere Variante dessen: Der Anspruch an die Verwirklichung der eigenen Genialität wird bei Eintritt abgegeben, dafür bekommt man seinen gut gefüllten Fressnapf hingestellt. Zwar erfüllen die Inhalte nicht immer die Vorstellungen, die man bei Beginn des Studiums hatte, vor allem kann man sie hier sicher nicht frei wählen, aber dafür gibt es einen stabilen und vor allem berechenbaren Berufsweg.
Was spricht dann dafür, einen Job bei einer womöglich unsicher finanzierten Biotechfirma anzutreten oder gar noch extremer: Mit anderen zusammen eine eigene Firma zu gründen?
Ja, auf den ersten Blick nicht sehr viel. Man arbeitet sicher genauso hart wie in den akademischen Nachwuchsjahren und die Bezahlung ist meist auch nicht viel besser. Es muss also etwas anderes sein, und da kommen wir wieder zu dem Faktor „X“, der besonderen Motivation.
Ich denke an meine Doktorandenzeit zurück, an die circa vier (sehr guten) Jahre bei meinem Doktorvater Friedrich Bonhoeffer, damals Max-Planck-Direktor in Tübingen und herausragender Neuro-Entwicklungsbiologe. Bei ihm fing die Wissenschaft mit der Frage an: Was will ich eigentlich wissen? Und nicht: Was bekomme ich denn finanziert? Oder: Wo kann ich die meisten Paper landen?
Mitten in seiner akademischen Karriere war er gezwungen gewesen, sein Forschungsgebiet zu verlassen und sich ein neues zu suchen. Bis Ende der 70er-Jahre war das Tübinger Max-Planck-Institut für Virusforschung zuständig, doch die nächste Generation an Direktoren sollte sich einen neuen Schwerpunkt suchen. Für Bonhoeffer war es die Frage, wie die neuronalen Verschaltungen während der Embryonalentwicklung zustande kommen und welche molekularen Faktoren daran beteiligt sind. Er suchte sich die retinotektale Projektion im Vogel- und Fischhirn als Modellsystem und entwickelte mit nur einer Technischen Assistentin zunächst ein erstes experimentelles Set-up. Mit diesem Testsystem konnte er die Entscheidung auswachsender Axone der Retinalzellen für ihr Zielgebiet im Mittelhirn („Tectum“) in vitro nachvollziehen, eine Meisterleistung... und die Grundlage für ein Nature-Paper.
Ich fing 1992 mit meiner Doktorarbeit an und nach drei spannenden, aber auch anstrengenden Jahren durfte ich die Ergebnisse meiner Arbeit, vor allem aber der Arbeit meines „kleinen Chefs“, also des Nachwuchsgruppenleiters Uwe Drescher, auf einem Cold-Spring-Harbour-Meeting vorstellen. Zum ersten Mal in den USA, zum ersten Mal allein auf einem wissenschaftlichen Meeting und dann kommen all die Granden des Felds vorbei, gratulierten und luden mich zu sich in die Labors ein. Das hatte ich auch vorher so geplant, dass ich nach dem Meeting an der Ostküste dann eine „Postdoc-Stellentour“ entlang der kalifornischen Küste machen würde. Ich besuchte verschiedene Gruppenleiter bei Genentech; der University of California, San Francisco; Amgen; der University of California, San Diego – aber am spannendsten war es bei Genentech. Von dieser Firma hatte ich schon einiges gehört, es war die erste „Biotech“firma, also ein Unternehmen, das extra gegründet worden war, um mittels „Genetic Engineering“ zum ersten Mal kommerziell verwertbare Proteine herzustellen. Ich hatte vorher bei einem Praktikum am MPI in München Axel Ullrich und einige seiner Postdocs kennengelernt, die alle bei Genentech in den frühen Jahren gearbeitet hatten.
War es der Name der Firma oder die Aura, dass es die erste Firma war, die die moderne Molekularbiologie als Geschäftsgrundlage hatte? Auf jeden Fall faszinierte mich Genentech und das wurde dadurch noch verstärkt, dass mir der Arbeitsgruppenleiter dort nicht nur einen Job anbot, sondern mir als Lektüre für den weiteren California-Trip ein Buch in die Hand drückte, das meinen weiteren beruflichen Weg prägen sollte: „Invisible Frontiers“, unsichtbare Grenzen. In diesem Buch (veröffentlicht 1982, leider keine Neuauflage, nur antiquarisch) beschreibt der Autor Stephen Hall, wie die wissenschaftlichen Gründer von Genentech, Herb Boyer und Bob Swanson, vor allem aber die Wissenschaftler der ersten Stunde, Peter Seeburg, Axel Ullrich, Ghobind Khorana und einige andere sich mit Walter „Wally“ Gilbert, Gründer von Biogen (jetzt Biogen Idec) in Boston, ein Wettrennen darum lieferten, wer als Erster einen brauchbaren Produktionsprozess für die Herstellung von rekombinantem Humaninsulin hinbekäme. Das war der Stoff, aus dem die Träume sind (zumindest die Tagträume des angehenden Molekularbiologen/Biochemikers).
Genentech und ihr rekombinantes Humaninsulin – der Prototyp eines Projekts, für das man wirklich alles geben konnte. Denn es hatte auch damals einen sehr hohen medizinischen Nutzen, die Diabetiker brauchten es dringend, weil es nicht mehr genügend Pankreata aus Schlachttieren gab. Sein kommerzieller Wert war schon damals sehr hoch. Nur ein Milligramm reicht für viele Injektionen. Und es hatte einen hohen Schwierigkeitsgrad, denn Insulin ist zwar nur ein kleines Protein oder eher ein Polypeptid, aber es besteht aus zwei Peptidketten mit Disulfidbrücken.
Also keine leichte, aber eine sehr lohnenswerte Aufgabe. Am Ende gewann das Genentech-Team um Axel Ullrich. Genentech lizenzierte das Humulin an die große etablierte Pharmafirma Eli Lilly und ging an die Börse. Bei dem Börsengang, dem sogenannten „Initial Public Offering“ (= IPO) am 14. Oktober 1980 notierte die Genentech-Aktie mit dem Symbol „GENE“ zu Beginn bei 35 US-Dollar. Der Kurs verdreifachte sich innerhalb von zwanzig Minuten, bis die Aktie dann nach einer Stunde vom Handel ausgesetzt wurde. Die Investoren der ersten Stunde, ein großer Venture-Capital-Fonds (VC-Fonds) namens Kleiner Perkins, hatten ihr erstes „Seed“-Investment von 100.000 US-Dollar um das 465-fache auf 46,5 Millionen Marktwert gesteigert.
Damit wurde der „Plot“ für viele weitere US-amerikanische Biotech-Erfolgsstories geschrieben. Ein Team aus brillanten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern entwickelt ein neues disruptives Medikament; parallel dazu finanziert sich die Biotechfirma aus Risikokapital oder Venture Capital. Diese VC-Fonds übernehmen einen großen Anteil der Firmenanteile und bei einem wissenschaftlichen Durchbruch oder einem klinischen Meilenstein geht die Firma an die Börse und der Wert des VC-Einsatzes vervielfältigt sich. Die Finanzierung treibt die Entwicklung der Medizin voran. Ärzte und Patienten profitieren von neuen Medikamenten, die wesentlich bessere Therapien versprechen. Beispiel dafür sind Avastin (auch von Genentech entwickelt), die erste Anti-Angiogenese-Krebstherapie, oder Sovaldi von Gilead, die erste antivirale Therapie gegen Hepatitis-C-Viren, die nicht nur Linderung, sondern echte Heilung bringt.
Meine Erkenntnis aus der Genentech-Geschichte war: Um wirklich neue disruptive Biotech-Produkte zu entwickeln, müssen Wissenschaft und Kapitalismus eine Allianz eingehen. Man muss die Mechanismen des Kapitalmarktes verstehen, um das eigentliche Traumziel, ein neues Medikament an den Markt zu bringen, das vielen Menschen hilft, zu erreichen. Und Biotech ist ja nicht auf Medikamente beschränkt, es warten noch viele biotechnologische Innovationen zur Rohstoffproduktion (zum Beispiel durch Solaralgen oder durch rekombinante Pflanzen und Bakterien), zur Abfallaufbereitung (Schwermetallextraktion) zur Herstellung von Bioplastik, zur gesünderen und nachhaltigeren Nahrungsmittelproduktion und vielem mehr. Die Grundgleichung der Innovation lautet:
Produkt-Innovation = brillante (wissenschaftliche) Idee x Kapital x Unternehmertum.
Die Wissenschaft, also die Idee und ihre Umsetzung im Labor, ist also nur einer von drei Faktoren. Den Kapitaleinsatz habe ich bereits kurz beschrieben. Aber was ist mit dem dritten Faktor, dem Unternehmertum?
Dafür möchte ich hier werben. Unter Unternehmertum verstehe ich den inneren Drang, eine Idee in Eigenregie umsetzen zu wollen. Dafür nimmt man als Unternehmer oder Unternehmerin viele Mühen, viele Entbehrungen und viele Rückschläge in Kauf. Als Unternehmer habe ich eine Vision, eine Vorstellung, was ich entwickeln will, wie es aussieht, wozu es gut ist und wie man es verkaufen kann. Unternehmer haben letztlich etwas mehr Fantasie als ihre Zeit- und Artgenossen und sind bereit, diese auszuleben. Im Gegensatz zur akademischen Forschung, die allermeist mit einer Publikation und dem Satz „This opens an avenue of new research in this exciting field of...“ endet, wird die Fantasie beim Unternehmer umgesetzt, während die akademische Wissenschaft sich selbst genügt, ein Perpetuum mobile ohne Übersetzungsriemen in die praktische und nützliche Welt zu sein.
Akademische Grundlagenforschung ist absolut notwendig und sollte nicht in Zweifel gezogen werden. Das Unlautere in weiten Teilen der medizinisch ausgerichteten akademischen Wissenschaft ist jedoch, dass sie suggeriert, dass die Steuermillionen und -milliarden, die dort abgebrannt werden, tatsächlich zu neuen Medikamenten und Therapien führen. Das ist aber nicht so, es sind vor allem die Biotech-Unternehmen, die neue Therapien entwickeln, die akademischen Forscher liefern allenfalls die Grundlage dafür.
Aber wir waren am Anfang bei der Entscheidung zur Berufswahl: Welchen Weg müsste ich denn einschlagen, wenn ich Biotech-Unternehmer oder -unternehmerin werden will? Hier möchte ich einmal erwähnen, dass es noch viel zu wenig Unternehmerinnen gibt; dabei haben Frauen in den Naturwissenschaften heute meistens die Nase vorne.
Ja, das ist der Clou an der Geschichte: Es gibt keinen festen Weg zum Unternehmer oder zur Unternehmerin. Sie sind Abenteurer, die sich den Weg selber suchen, das ist der Kern des Unternehmertums. Sie haben eine feste Idee, wo sie hinwollen, das Ziel ist klar, nur der Weg ist unbekannt. Sicher ist nur, dass viele Schwierigkeiten und Herausforderungen unterwegs warten.
Lassen Sie mich wieder mit einem Bild dazu schließen. Im 19. Jahrhundert musste man, wenn man vom Atlantik in den Pazifik oder umgekehrt gelangen wollte, den langen Seeweg um Südamerika herum, um das Kap Hoorn nehmen, eine elends lange Strecke. Man vermutete, dass die Route nördlich um Kanada herum viel kürzer sein sollte, nur sicher konnte man sich nicht sein. Diese sogenannte „Nordwestpassage“, wenn sie denn existierte, wäre sicher nur im Sommer eisfrei passierbar, sollte aber dann schneller als die Südroute gehen. Die Entdeckung der Nordwestpassage hat viele Entdecker und Abenteurer angetrieben und viele sind im Eis gescheitert. Aber sie hatten ihr Ziel klar vor Augen.
Im Unterschied zu diesen Entdeckern müssen wir Biotech-Unternehmer nicht unser Leben riskieren, zumindest nicht das physische Leben, aber doch die berufliche Existenz. Wir müssen unsere ganze Energie, das ganze Denken, Intelligenz, Mut und Durchhaltevermögen auf den Erfolg auslegen... mit dem Ziel, neue Werte zu schaffen. Die Biotechnologie verdient es, Biotech-Medikamente haben die höchste Wertschöpfung aller industriell hergestellten Produkte: ein Gramm Insulin hat den 10.000-fachen Wert der gleichen Masse an Gold; der Wert steckt in dem Wissen, das um dieses Produkt akkumuliert wurde. Somit ist die Biotechnologie ein Paradebeispiel für eine Wissensindustrie. Unsere Politik führt solche Begriffe gerne im Munde, doch hat hierzulande niemand an den entscheidenden Schaltstellen verstanden, was notwendig ist, um Wissen in Produktinnovationen zu verwandeln – nämlich Ideen x Kapital x Unternehmertum. Und alle drei gilt es zu fördern.
Zum Autor
Claus Kremoser studierte Biochemie und promovierte 1996. Heute ist er CEO des Heidelberger Unternehmens Phenex Pharmaceuticals, das Kremoser 2002 zusammen mit Thomas Hoffmann gegründet hat.
Letzte Änderungen: 07.07.2020