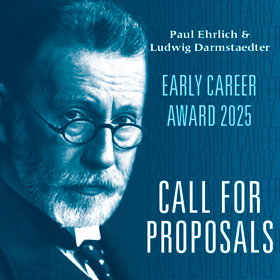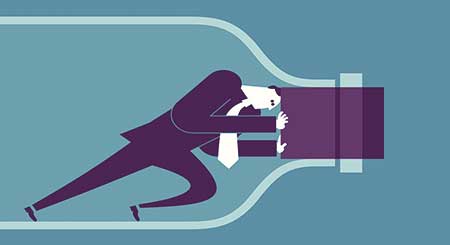Überdenken
Jenseits des Hamsterrads
Von Stephan Feller, Halle
(12.07.2017) Was kommt heraus, wenn man mit der Schrotflinte in alle möglichen Ecken des Wissenschaftsbetriebs feuert? Ein schmerzvoll anzuschauender Trümmerhaufen. Aber daraus erwachsen auch Verbesserungsvorschläge.
“But I don’t want to go among mad people,” Alice remarked.
“Oh, you can’t help that,” said the Cat:
“We’re all mad here. I’m mad. You’re mad.”
“How do you know I’m mad?” said Alice.
“You must be,” said the Cat, “or you wouldn’t have come here.”
(Lewis Carroll, Alice in Wonderland)
Auch wenn ich hier etwas wild über tatsächliche Zahlen spekuliere, so erscheint es mir doch eine unbequeme und deswegen weithin ignorierte Wahrheit, dass über 95 Prozent der Wissenschaftler samt ihren Publikationen gerade mal zwanzig Jahre nach ihrem Abgang aus der aktiven Forschung bereits wieder völlig vergessen sind.
Trotzdem investieren immer mehr Forscher mehr und mehr Zeit mit dem Polieren ihrer aktuellen Zitierungszahlen, dem Aufblasen ihrer h-Indizes (Hirsch-Faktor, misst die wissenschaftliche „Geweihgröße“) und anderer vermeintlicher Wertschätzungsfaktoren, sowie dem Ansammeln der verschiedensten Formen von zweifelhaften „Aktivitätspunkten“ – als wären sie Unsterbliche, die nur durch Enthauptung oder eine silberne Kugel ins Herz jemals gestoppt werden könnten.
Zunehmend verwenden wissenschaftliche Kommissionen diese oftmals fehlerhaften Schätzwerte als Surrogate, mit denen sie vorauszusagen versuchen, wer zukünftig maximal produktiv sein wird. Auf diese Weise wählen sie dann Kandidaten für massiv unterfinanzierte Positionen in Evaluations-geschüttelten Instituten aus – scheinen aber oft um jeden Preis vermeiden zu wollen, die konkreten Veröffentlichungen der Bewerber wirklich gründlich lesen zu müssen.
Man kann sich daher schon fragen: Sind wir auf dem besten Weg, „Wissenschafts-Zombies“ zu werden?
Schneller und schneller sammeln sündhaft teure Maschinen immer größere Datenberge, die niemand wirklich versteht (Chapeau! für Sydney Brenner, der schon sehr früh auf dieses Problem hindeutete). Zunehmend werden „Ressourcen“-Artikel veröffentlicht, in der Hoffnung, dass irgendjemand irgendwo irgendwann irgendwelchen Sinn in diesen turmhohen Ansammlungen von fehlerverseuchtem Chaos entdeckt. Viele GWAS-Analysen (von genome-wide association study) sind hier ein gutes Beispiel.
Mehr und mehr Autoren drängen sich in Publikationen mit stetig wachsenden Methodenportfolios hinein, bis kein einzelner von ihnen mehr in der Lage ist, den gesamten Inhalt und die tatsächliche Bedeutung der Artikel vollständig zu erfassen, auf denen sie selbst mit draufstehen.
Zugleich wollen manche Artikel mit einem 120-seitigen Supplement beeindrucken und verwandeln dadurch die Vorbereitung von Journal-Clubs zu wochenlangen Folterübungen. Wieder andere Autoren versuchen die kleinste veröffentlichbare Einheit neu zu definieren, um die Häufigkeit ihrer Paper-Ausflüsse zu maximieren (und damit gleichzeitig Impakt-Punkte irgendwelcher Art).
Über 30.000 wissenschaftliche Zeitschriften – darunter viele, die von recht zwielichtigen Gestalten mit offensichtlichem Sitz in Spamalot-Castle betrieben werden – nerven uns unaufhörlich, indem sie uns fast täglich mit Müll-Mails bombardieren, in denen sie um Manuskript-Futter betteln. Dazu scheint sich in gewissen Ländern wissenschaftliche Kreativität hauptsächlich in der Erfindung immer neuer Formen von Peer-Review- und Editor-Betrügereien, sowie verschiedenen Spielarten der betrügerischen Autorenschaft-Erschwindelung zu manifestieren.
Wissenschaftler verbringen endlose Stunden als Journal-Reviewer und -Editoren; und müssen dann überteuerte Zeitschriftenabonnements kaufen, oder viel Geld für die Downloads einzelner Artikel zahlen, manchmal sogar für die eigenen (!) – während scheinbar sehr gierige Verleger erstaunliche Gewinne scheffeln.
Die Wissenschaftsgesellschaften und -förderer wollen jedoch offensichtlich nicht damit belästigt werden, das wissenschaftliche Publizieren wieder zurück in die Hände der Wissenschaft zu bringen, was vielleicht dazu beitragen würde, kontraproduktive Auswüchse (zum Beispiel „Reviewmania“ zur Steigerung von Impakt-Faktoren) im wissenschaftlichen Verlagswesen deutlich einzudämmen, da diese zu großen Teilen von nichtwissenschaftlichen, kommerziellen Interessen getrieben werden. Die Wissenschaftsgemeinde muss dringend weniger Paper veröffentlichen und nicht etwa mehr! Niemand, und ich meine WIRKLICH NIEMAND, hat die Zeit, den ganzen Unsinn zu lesen, der derzeit sogar innerhalb eines einzigen Spezialgebiets tagtäglich auf die Menschheit losgelassen wird.
Die Zahl des Verwaltungspersonals an vielen Universitäten wächst stetig, und zunehmend drängen sie mit immer nervenderen Forderungen der Art „Entschuldigung-aber-wir-müssen-diese-Sache-unbedingt-juristisch-wasserdicht-absichern-und-brauchen-dazu-umgehend-noch...“ in die wertvolle und sehr begrenzte Zeit von uns Wissenschaftlern hinein. Sogar Weltklasse-Unis, wie die in Oxford, bleiben davor nicht verschont. Die Konsequenz ist, dass Wissenschaftler immer weniger Zeit aufbringen können, um wirklich tief und sorgfältig über Strategien nachzudenken, wie sie ihre Forschungsprojekte besser entwickeln könnten. Noch weniger Zeit bleibt – und das wäre vielleicht sogar noch wichtiger –, in der Wissenschaftler kostbare Stunden mit ihren Kollegen in lockerer Plauderei darüber verbringen dürfen, welche wirklich großen neuen Fragen gestellt werden müssen und wie diese am besten angegangen werden können.
Heutzutage werden viele unserer Universitäten wie schlechte Kopien von Unternehmen betrieben. Nicht zuletzt deshalb haben die administrativen Mitarbeiter oft feste Stellen, während viele Wissenschaftler stetig darum kämpfen müssen, ihre befristeten Verträge noch einmal verlängert zu bekommen. Dies passiert oft nur dann, wenn sie genug Overhead-Geld generieren – mit dem dann am Ende noch mehr administrative Mitarbeiter finanziert werden. Der Schwanz wedelt mit dem Hund – Wahnsinn pur!
Inzwischen gilt es auch vielerorts als Norm, dass „leistungsorientierte“ Gehälter für Principal Investigators einerseits an das Einwerben von ausreichenden Fördersummen gekoppelt sind, andererseits aber auch an die Erreichung einer gewissen Anzahl von Impakt-Punkten (Journal Impact Factor, CiteScore et cetera – Messgrößen, die übrigens alle von kommerziellen Anbietern mit eigener Agenda in ziemlich intransparenter Weise generiert werden und durchaus fehlerbehaftet sind). In unserer glorreichen Vergangenheit hätten viele hoch motivierte und engagierte Wissenschaftler tief beleidigt reagiert, wenn jemand versucht hätte, derart dreist das Karotte-Stock-Spiel mit ihnen zu spielen, als wären sie Esel; heute sind wenigstens ein paar Wenige noch genervt genug, um die Karotte gar nicht erst anzubieten beziehungsweise zu verweigern. Viele hochgeehrte Preisträger unter den Forschern haben inzwischen glasklar gesagt, dass sie unter den heutigen Bedingungen keinerlei Chance auf eine Karriere in unseren Wissenschaftsinstituten hätten. Warum wird das von den Verantwortlichen weitestgehend ignoriert?
Es ist schlichtweg dumm, zu glauben, dass man einem ernstzunehmenden Wissenschaftler nur ein paar Geldsäckchen vor die Nase halten muss, damit er bessere Wissenschaft macht, origineller ist – oder gar öfter über völlig unerwartete und höchst eigenartige Befunde stolpert, die letztlich ganz neue Türen aufstoßen. Im Wesentlichen ist die Karotte-Stock-Methode also nichts anderes als das Eingeständnis der eigenen Unfähigkeit einer Institution, Wissenschaftler zu finden, auszuwählen beziehungsweise dann auch wirklich anzulocken, die ganz von sich aus eine hohe Motivation und die richtigen Prioritäten verinnerlicht haben.
Viele biomedizinische Paper, die in den letzten Jahren veröffentlicht wurden, sind offenbar teilweise oder sogar vollständig unreproduzierbar. Dies befeuert zum Beispiel das (teilweise auch selbstverschuldete) Elend der Pipeline-Dürre von großen Pharma-Unternehmen. Diese stecken nichtsdestotrotz häufig das mehrfache an Geld, das sie in tatsächliche Forschung und Entwicklung investieren, ins Marketing, um mit zum Teil lächerlichen Werbekampagnen marginal nützlichere, aber sehr teure (das heißt: rentable) neue Medikamente in den Markt zu drücken. Das hier weiter zu vertiefen, wäre aber ein ganz anderes Thema, deshalb zurück zur akuten Reproduzierbarkeitskrise in der biomedizinischen Forschung...
Was, so muss man fragen, motiviert jemanden eigentlich, in die durchaus mühselige wissenschaftliche Forscherarbeit einzusteigen, wenn nicht der aus tiefstem Herzen verspürte Drang, sich auf die Suche nach wirklich neuen Dingen zu machen und vielleicht so der Wahrheit ein Stück näher zu kommen? Vielen Medizinern scheint es jedoch inzwischen auszureichen, ihre Forschung auf deutlich unterdurchschnittlichem Niveau zu praktizieren und bestenfalls einen flüchtigen Augenblick unverdienten Ruhms einzuheimsen, bevor sich die betreffende Studie dann als unhaltbar herausstellt.
Dummerweise ist das Veröffentlichen von Artikeln mit Resultaten, die niemand reproduzieren kann, aber nicht nur unglaublich langweilig, sondern es generiert auch massive Hindernisse für den weiteren wissenschaftlichen Fortschritt und sorgt somit für eine enorme Verschwendung von höchst wertvoller, da eindeutig begrenzter Forscher-Lebenszeit (und von sehr viel Geld). Dennoch müssen all die überehrgeizigen und rücksichtslosen Forscherkollegen, die auf der Welle schlampiger oder gar betrügerischer Wissenschaft reiten, bisher in aller Regel nur sehr milde Strafen fürchten. Selbst wenn sie niemals wieder ein Forschungslabor betreiben dürfen, so können sie doch – zumindest als Mediziner – dank Approbation trotz aller Betrügereien bis an ihr berufliches Lebensende durchaus lukrativ Patienten weiter behandeln, als wäre nichts weiter geschehen.
Eine weitere Folge unseres überhitzten Wissenschaftsbetriebe ist auch, dass das „Abkürzen“, das Reduzieren von Kontrollen auf ein Minimum und das Weglassen wichtiger experimenteller Details inzwischen fast schon zu einem allgemeinen Wesenszug vieler Studenten, Doktoranden und Postdocs geworden ist – mit ausgelöst auch dadurch, dass Nachwuchsforscher inzwischen mehr und mehr vor allem zum egozentrischen Zwecke der Maximierung eigener Impakt-Zahlen herangezüchtet werden. Viele Forscher-Novizen erhalten heutzutage keinerlei vernünftige Unterweisung über die absolute Notwendigkeit von umfangreichen Kontrollexperimenten zur Vermeidung von Fehlschlüssen und Artefakten. Ein vorgeblicher Zeitmangel, der sie hindert, an entsprechenden Unterweisungen teilzunehmen, wird vielfach einfach stillschweigend akzeptiert oder sogar ermutigt. Schnelligkeit ist heute Trumpf, Gründlichkeit war gestern.
Um förderungswürdig zu sein, verlangen viele Forschungsförderer und -politiker in diesen Tagen einen derart offensichtlichen translationalen Wert der Forschungsprojekte, dass selbst der schlichteste Geist deren angeblich überragende, oftmals aber nur fantasierte, Bedeutung zum Wohle der Menschheit augenblicklich erfassen kann. Fügt man nun noch die endlosen Berichte über Wundermittel in Boulevardblättern hinzu – oft präsentiert von Super-Ego-„Wissenschaftlern“ oder Scharlatanen – und lässt immer wieder aufs Neue den „totalen Krieg gegen den Krebs“ grüßen, dann hat der halbwegs gebildete Mitbürger inzwischen durchaus wieder das Recht, das alte Klischee des „verrückten Wissenschaftlers“ erneut zu bemühen.
Inzwischen hat sich ein tiefes Missverständnis wie ein Lauffeuer in unserer Gesellschaft und sogar in Teilen der Forschergemeinde verbreitet – nämlich die Annahme, dass der wissenschaftliche Entdeckungsprozess ebenso rational und stromlinienförmig konzipiert und gestaltet werden kann wie die Produktionen auf den Fließbändern der Fabriken. Das trifft bestenfalls für ziemlich triviale Projekte zu. Wirklich originelle Durchbrüche können aber schlichtweg nicht geplant werden. Ein gutes Forschungslabor ist nun mal keine Wurstfabrik. Sicher, für einen solchen Durchbruch braucht es Geld und häufig allermodernste Werkzeuge; vor allem aber braucht es dazu einen spielerischen Freiraum, in dem sich wirklich kreative Köpfe gut entfalten und auch sehr ungewöhnliche Ansätze verfolgen können – selbst wenn diese naturgemäß ein erhebliches Risiko des spektakulären Versagens in sich tragen.
Meist geschehen wissenschaftliche Quantensprünge nicht auf geraden „Forschungs-Autobahnen“. Zu oft sind diese nämlich von starren Leitplanken eingefasst, selbst wenn sie oft mit riesigen Geldsummen gepflastert sind, auf die große, träge und letztlich oft schlecht organisierte Konsortien nur warten, um sie sich zu schnappen. Querdenker haben da kaum eine Chance, die stören da nur den Fluss.
Spektakuläre Fortschritte passieren vielmehr häufig auf kleinen, kurvenreichen Straßen mit Straßensperren, Umwegen und Sackgassen. Diese verschlungenen Pfade zu großem wissenschaftlichen Ruhm führen typischerweise durch dicken Nebel, zähen Schlamm und tiefe Schlaglöcher, mit nur gelegentlichen Ausblicken auf hellen Sonnenschein. Und wenn solch ein Durchbruch dann doch endlich geschafft ist, kann es immer noch eine lange Zeit dauern, bis die Erkenntnis schlussendlich vom wissenschaftlichen Mainstream akzeptiert wird. Bereits etablierte Ansichten können deren Akzeptanz durchaus über viele Jahre behindern. Manche meinen daher sogar, dass der wissenschaftliche Fortschritt „one funeral at a time“ voranschreitet – also immer dann, wenn ein „Großkönig“ eines relevanten Forschungsgebietes abtritt.
Der Nobelpreisträger David Baltimore hat während seines Vortrags „Is small science over?“ im Jahre 2001 (zur Feier von 100 Jahren Rockefeller University) durchaus Wichtiges gesagt. Im Wesentlichen ermutigte er die Wissenschaftler dazu, aus dem Hamsterrad herauszuspringen, sobald sie auf einer festen Stelle sitzen. Allzu vielen scheint dann nämlich gar nicht mehr bewusst zu sein, dass sie nun endlich die Freiheit haben, höhere Risiken einzugehen, um – vielleicht – wirklich wichtige Fragen zu lösen.
Voltaire wird der Ausspruch zugeschrieben: „Beurteile die Menschen eher nach ihren Fragen als nach ihren Antworten“ – und es stimmt: Kleine Fragen zeitigen fast immer – selbst im besten Falle – kleine Antworten. Tief drinnen wissen wir das alle, aber wir fühlen uns heute gezwungen, immer öfter die langweiligen, gut ausgebauten Straßen zu nehmen, nur um das Labor irgendwie am Leben zu erhalten, um von unseren Förderungs-Overheads Laborraum und weiteres Personal zu finanzieren – und in manchen Ländern sogar, um unsere eigenen Gehälter zu bezahlen.
Lang vorbei sind die Tage, in denen Wissenschaftler stolz verkünden konnten: Meine Forschung ist wirklich ein großer Spaß, obwohl ich nicht die nebulöseste Vorstellung habe, ob meine Erkenntnisse jemals für irgendjemanden nützlich sein werden – abgesehen von mir selbst, dessen unersättliche Neugier sie befriedigen. Willkommen in der Wissenschaft des dritten Jahrtausends!
Was bietet uns Hoffnung? Vielleicht eine neue Generation von hellen, jungen Köpfen, die – blitzsauber, unverbraucht, idealistisch, energiegeladen, kreativ und engagiert – aus dem aktuellen Sumpf ausbrechen und alles viel besser machen werden?
Ich bin mir da leider nicht so sicher.
Ist es nur meine Einbildung, oder verfügt die große Mehrzahl der heutigen Studenten tatsächlich über immer stärker schrumpfende Aufmerksamkeitsspannen – manchmal so kurz, dass sie offenbar schon mit derjenigen eines Goldfischs konkurriert? Ist Löffel-Fütterung von Infotainment-Bits inzwischen das einzige Mittel, mit dem viele unserer allerjüngsten Novizen auch nur die grundlegendsten wissenschaftlichen Konzepte verstehen können? Wächst bei diesen Jugendlichen stetig der Glaube, dass sich sowieso bald KI-Algorithmen um alle Komplexitäten für uns kümmern werden – weswegen es tatsächlich keine Notwendigkeit mehr gäbe, selbst allzu sehr nachzudenken? Haben ihre immer leistungsfähigeren Smartphones sie bereits in „Smombies“ verwandelt, bevor sie auch nur ansatzweise mit wissenschaftlichen Anstrengungen in Berührung kommen?
Was ist passiert mit der guten, alten, ehrlichen, unersättlichen Neugierde? Ist sie erwürgt worden durch die enorme und ständig weiter wachsende Überflutung mit billigem Schabernack, Reality-Show-ähnlichen Schnipseln und Social-Media-Geschnatter, wie sie in diesen Tagen endlos aus allen Poren des Internets tropfen?
In manchen Seminaren habe ich tatsächlich das Gefühl, eine Herde Schafe zu unterrichten. Ich muss zugeben, dass ich dann immer häufiger den Drang verspüre, durch Aktivierung eines Handy-Störungsgeräts die „digitale Entgiftung“ dieser armen Seelen zu erzwingen, obwohl dies derzeit noch illegal wäre. Im Gegenzug würde den Studenten beispielsweise erlaubt sein, ihre Kommilitonen (und mich) bei großer Langeweile mit Papierkügelchen oder nassen Schwämmen zu bewerfen – was uns alle am Ende wieder in vollem Umfang in das Hier und Jetzt (für Gamer: <- RL) zurückbefördern würde.
In den guten alten Zeiten, das heißt von der Antike eines Sokrates bis zum Ende des 2. Jahrtausends A. D., konnten wir uns fröhlich über die rebellischen, widerspenstigen Jugendlichen mit den schlechten Manieren beschweren, die Älteren wenig Respekt entgegen brachten, aus vollem Herzen ihren Eltern widersprachen, die Lehrer missachteten, et cetera. Heute gibt es nörgelnden Protest vor allem wenn das WLAN schwächelt. Kollektive intellektuelle Amnesie von putativ aufstrebenden Nachkommen, eine allgemeine Dumpfheit, Realitätsflucht und die ignorante Hinnahme gefährlicher gesellschaftlicher Entwicklungen waren niemals zuvor ein Jugendthema. Shit Storms in den Sozialen Medien sind, wie ich meine, kaum geeignet, um unsere Welt besser zu machen. Bloßes Jammern über lokal fehlende Breitbandanschlüsse ist keine sinnvolle Gesellschaftskritik. Irgendwie scheinen sich viele unserer Jugendlichen inzwischen der Herrschaft risikofeindlicher Gerontokraten in einer alternden Gesellschaft unterworfen zu haben, ohne sich vorher überhaupt irgendeiner Art von Kampf zu stellen. „Intensiv leben wollte ich, das Mark des Lebens in mich aufsaugen“, schreibt Thoreau so brillant. Wohin ist dieser Geist entschwunden? Machen die neuen, digitalen Medien viele von uns zunehmend zu blutleeren, traurigen Gestalten?
Somit wäre nun also erkennbar, dass auch die Welt außerhalb unseres Elfenbeinturmes immer verrückter zu werden scheint. Hier noch ein letztes Beispiel. Nach dem (mutmaßlichen) Untergang des bösen sowjetischen Reiches durfte der entfesselte Kapitalismus ungebremst lostraben und stolz seinen hässlichen Kopf erheben – anfänglich in der Form des „Raubtier-Kapitalismus“, wo Hedge-Fond-Heuschrecken alles fraßen, was ihnen über den Weg lief; gefolgt vom „Pampers-Kapitalismus“ (Motto: „Privatisiere die Gewinne, verstaatliche die Verluste“), wo Banken und andere multinationale Unternehmen ein riesiges Chaos anrichteten und die Steuerzahler nicht nur die Hintern dieser Geldverbrenner abwischen, sondern auch für ihre neuen Windeln bezahlen durften. Dann kamen die lächerlichen Vorschläge vom „Helikoptergeld“, welches aus Hubschraubern völlig zufällig unter das gemeine Volk geworfen wird, um irgendwie die lahmenden, kapitalistischen Wirtschaften zu stimulieren; und vor kurzem erst sind wir in das überaus glorreiche „Postfaktische Zeitalter“ eingetreten, in dem üble Demagogen wieder völlig frei wanderpredigen und es anscheinend völlig okay ist, Lügen und hasserfüllte Emotionen zu verbreiten und sogar zur Gewalt gegen andere aufzuwiegeln.
Was es für die Wissenschaft bedeuten würde, ähnlich üble, unehrliche Machenschaften, etwa beim Klimaschutz oder in der Evolutionstheorie, für salonfähig zu erklären, muss man nicht lange erörtern. Es lässt sich in drei kurzen Buchstaben erschöpfend zusammenfassen: TOD.
Aber auch wenn, wie wir alle hoffen und vielleicht auch beten, die meisten Wissenschaftler nicht auf diese schiefe Bahn geraten, so sind sie dennoch ernsthaften Bedrohungen durch einige Politiker ausgesetzt, die scheinbar nicht zögern, die Wahrheit in nahezu orwellianischer Art und Weise zu verzerren (siehe zum Beispiel Nature 541: 133).
Ich bin mir nicht sicher, ob ich an dieser Stelle tragfähige, gewaltlose Lösungen anbieten kann, um die fröhlich proliferierenden, leider jedoch überaus gefährlichen, narzisstischen Clowns à la „The Donald“ zur Rettung der Welt (und damit natürlich auch der Wissenschaft) aufzuhalten. Aber vielleicht können ja auch kleinere Schritte hilfreich sein. Gibt es also wenigstens für zukünftige Möchtegern-Wissenschaftler irgendwelche Optionen, wie sie das Hamsterrad-Chaos und die Fallstricke der wissenschaftlichen Desintegrität vermeiden können? Wie kann unsere nächste Generation – zumindest diejenigen vielversprechenden Exemplare, die trotz allem noch zu beobachten sind – sich im wissenschaftlichen Entdeckungsprozess engagieren, ohne in ernsthafte Gefahr zu geraten, im System vor lauter Frust die Lust zu verlieren?
Hier sind zumindest ein paar, wenn auch zugegebenermaßen ziemlich weit hergeholte Vorschläge (... verzweifelte Zeiten erfordern verzweifelte Maßnahmen ...):
- Stellen Sie sicher, dass Sie in eine sehr wohlhabende Familie geboren werden. Sicherlich keine Option für die überwiegende Mehrheit von uns – es sei denn, Sie glauben an Reinkarnation. In diesem Fall versuchen Sie, so viele „Karma-Punkte“ wie möglich zu sammeln, indem Sie, so oft Sie können, überaus nett zu Ihren Mitmenschen sind.
- Wenn Sie es schaffen, suchen Sie sich einen reichen Lebenspartner, der Ihren Lebensunterhalt garantiert und Ihnen damit erlaubt, Wissenschaft als Hobby zu betreiben. Werden Sie dann freiwilliger Sklave in einem großartigen Labor Ihrer Wahl, wo Sie Ihre Träume verfolgen können, ohne dass Ihnen jemand allzu enge Fesseln anlegen kann. Noch besser wäre allerdings, Sie fänden einen sehr reichen Partner, der Ihnen Ihr eigenes, voll ausgestattetes Forschungslabor bieten kann – genau wie in den guten alten Zeiten, in denen das Privileg zu forschen auf wohlhabende Adlige beschränkt war (natürlich unterstützt von einer Schar bezahlter Marionetten).
- Natürlich bin ich mir bewusst, dass die Vorschläge 1 und 2 für die meisten von uns keine Optionen sein können. Daher schlage ich vor, dass wir stattdessen alle für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) für akademische Wissenschaftler kämpfen. Das BGE müsste nicht nur für ein schlichtes Gehalt sorgen, sondern brächte zugleich ein kleines Budget für Verbrauchsmaterialien mit sich, plus einen gewissen Betrag an wissenschaftlichem Spielgeld, das nur für Projekte anderer Wissenschaftler verwendet werden dürfte.
Um als BGE-Wissenschaftler akzeptiert zu werden, müsste man natürlich strengen Auswahlkriterien genügen, wie dem Ansparen von ausreichenden „Nerd-Punkten“ oder anderen intelligenten Messgrößen, die noch genauer ausgearbeitet werden müssten. Und um teure Hochdurchsatz-Forschungsprojekte zu starten, müssten BGE-Wissenschaftler mehrere Gleichgesinnte finden, die bereit sind, ihr wertvolles Spielgeld in diese würdige Sache einfließen zu lassen. Natürlich wären gründliche Diskussionen und „intellektuelles Armdrücken“ nötig, um ein solches wissenschaftliches "Crowd-Funding“ zu organisieren – was wieder viel Spaß ins akademische Leben zurückbrächte.
Das BGE würde alle ehrlichen Wissenschaftler, wie Dich, lebenslänglich versorgen. Es ginge Dir nur verloren, wenn sich Deine Paper doch noch als Betrug herausstellen sollten, durch Deine eigene schwere Schuld komplett unreproduzierbar wären, oder wenn Deine Arbeit so schamlos trivial wäre (also nie mehr als das völlig Offensichtliche liefern würde), dass Dir als einzige ehrenhafte Möglichkeit bliebe, freiwillig davon zurückzutreten.
Besonders kühne und wirklich faszinierende Ideen würden dagegen belohnt und gegebenenfalls sogar ohne umständlichen Peer-Review publiziert – und zwar in einer neuen Gattung von prestigeträchtigen Open Access-Zeitschriften, die extra dafür da sind, bemerkenswerte innovative Konzepte sowie spekulative, aber höchst neuartige Ansätze zu verbreiten, welche zumindest theoretisch das Potenzial haben sollten, Grundlagen für zukünftige Durchbrüche zu schaffen.
Dies alles würde aus den Gewinnen der Arbeit von Robotern (und sonstigen Maschinen) bezahlt, die uns sowieso bald viele unserer langweiligen Gegenwartsjobs abnehmen werden, dann aber zur Strafe eine neueinzuführende, ordentliche Robo-Tax zahlen müssen.
Das Hamsterrad, das viele heutige Wissenschaftler dazu zwingt, hyperhektisch und ohne viel Freiheit zu arbeiten, nur um in der Wissenschaft zu überleben, anstatt ihre Forschungsarbeit zu genießen, wäre dann bald bloß noch eine blasse Erinnerung aus grauer Vorzeit, die nur gelegentlich noch in den Alpträumen älterer Kollegen wieder auftaucht, die unser aktuelles Elend noch aus erster Hand erlebt haben.
Aber klar, leider wird im wirklichen Leben wahrscheinlich nichts davon in nächster Zeit passieren. Wie also könnten reale Lösungen aussehen?
Eine umfangreiche „Entrümpelung“ unserer Universitäten wäre vermutlich großartig. Wenn man zügig all diejenigen Studenten loswürde, die ziemlich eindeutig unfähig sind, jemals etwas Bemerkenswertes in der akademischen Wissenschaft zu leisten – konkret also nach Abschluss ihres Bachelors – dann könnte das durchaus viel bringen. Master-Studiengänge würden nur den circa zehn Prozent Besten angeboten werden, das heißt denjenigen, die das Potenzial haben, sie auch wirklich vernünftig zu bewältigen und so zu echten „Meistern“ der akademischen Wissenschaft zu werden. Das brächte dann auch viel Zeit für ein ordentliches Mentoring von denjenigen, die wirklich vielversprechend sind. Sie würden folglich von früh auf die wesentlichen Tricks und Kniffe der Forschungskunst erlernen, einschließlich der verschiedenen Soft-Skills, die zum Erfolg erforderlich sind. Die Entwicklung persönlicher Beziehungen zu den Senior-Wissenschaftlern würde wieder einfacher werden – was dann vielleicht auch den „Vater“ wieder zurück in den schönen, aber derzeit oft hohlklingenden Terminus „Doktorvater“ bringen könnte (natürlich gilt alles, was hier aus Gründen der besseren Lesbarkeit ohne Gendersternchen et cetera pp. geschrieben wird, für alle der zahlreichen, interessanten Spielarten des Homo sapiens).
Ganz offensichtlich würde es dann deutlich weniger Jungforscher geben, aber die wären von höherer Qualität und Qualifikation – und könnten, versorgt mit den richtigen Ressourcen und optimalem Mentoring, viel Substantielles erreichen, selbst wenn sie insgesamt weniger publizieren. Weniger Absolventen würde auch einen deutlich weniger heftigen Wettbewerb um bezahlte akademische Postdoc-Stellen bedeuten – und wahrscheinlich eine Verschiebung der Förderflüsse weg von der bevorzugten Finanzierung vieler Doktoranden hin zu höheren Förderquoten für promovierte Wissenschaftler. Und irgendwann könnten dann vielleicht auch wir hektischen Wissenschaftshamster unser Tempo im Laufrad drosseln – und eventuell sogar eines Tages ganz aus diesem verrückten Rad heraushüpfen, das die Wissenschaft schon viel zu lange in einem ungesunden Overdrive-Modus gehalten hat.
Bei alledem wäre es sicherlich sehr nützlich, wenn auch die Wissenschaftsförderer leichter akzeptieren, ja vielleicht sogar fordern könnten, dass die Wissenschaftler ihre Zeit aufteilen und gleichzeitig an mindestens zwei Projekten arbeiten: eines ein solides „Brot-und-Butter“-Projekt, das eher niedrig hängende Früchte erntet; das andere dagegen ein deutlich riskanteres, aber dennoch gut konzipiertes „Blue Sky“-Projekt mit Potential für einen hohen Erkenntnisgewinn. Jeder künftige Förderantrag müsste dann ein Projekt beider Typen umfassen. Misserfolge beim Verfolgen riskanterer Pfade würden auf diese Weise generell akzeptabler und die tatsächliche Verwendung von Mitteln deutlich flexibler. Bis jetzt sind Kreativ-Fördertöpfe leider noch viel zu selten, aber sie sind keine reine Illusion (siehe etwa das Förderprogramm „Experiment! “ der VolkswagenStiftung).
Unsere würdigen Nachwuchswissenschaftler könnten wir auf diese Weise häufiger dazu ermutigen, nach höheren Zielen zu streben, kühn zu sein und deutlich größere Risiken einzugehen, als sie es gegenwärtig wagen können, ohne ihre Zukunft aufs Spiel zu setzen. Sie haben nur ein Leben zu leben. Warum sollten sie dann ihre Karriere damit vergeuden, fast ausschließlich an kleinen Fragen zu arbeiten?
In der schönen neuen Wissenschaftswelt, von der ich träume, würden die Fördergelder, die eingeworben und ausgegeben werden, nicht per se als Tugend angesehen werden. Es würden vielmehr diejenigen Wissenschaftler besonders geschätzt, die im besten Interesse unserer Gesellschaft handeln, indem sie möglichst große Fortschritte mit möglichst moderaten Mengen an Geld erreichen. Große „Strohfeuer“-Projekte, die im Wesentlichen nur Egozentrik-getragene Geldverbrennungsübungen sind, wären dagegen verpönt und würden nicht zu Beförderungen führen.
Um es zusammenzufassen: Ich schlage vor, dass die Universitäten aufhören sollten, immer bizarrere, hyperaktive Formen der Ökonomie nachzuahmen, beziehungsweise ihnen sklavisch zu dienen – sei es nun der „Pampers-Kapitalismus“ oder eine andere verrückte Spielart. Unsere Universitäten müssen wieder viel stärker zu echten Brutstätten und Wiegen für kühne, kritische Vordenker werden und weniger zu Produzenten von willfährigen Knechten multinationaler, unkontrollierbarer Kapitalmonster. Nur dann werden sie in der Lage sein, die hellsten und kühnsten Köpfe anzuziehen und zu halten.
Lasst uns den Spaß zurück in die Wissenschaft bringen!
Zum Autor
Stephan Feller ist Professor für Tumorbiologie am Institut für Molekulare Medizin, ZAMED, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Letzte Änderungen: 12.07.2017