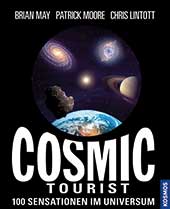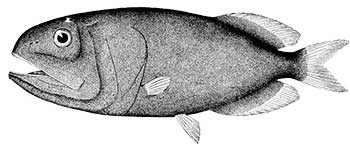Buchbesprechung
Winfried Köppelle

|
Olaf Stapledon:
Die letzten und die ersten Menschen.
Gebundene Ausgabe: 464 Seiten
Verlag: Piper (5. Oktober 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3492703623
ISBN-13: 978-3492703628
Preis: 25,00 Euro (gebundene Ausgabe), 18,99 Euro (Kindle Edition)
|

|
Hermann-Michael Hahn & Gerhard Weiland:
Nachtleuchtende Sternkarte für Einsteiger.
Taschenbuch: 2 Seiten
Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 2 (11. Juni 2015)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3440147924
ISBN-13: 978-3440147924
Preis: 14,99 Euro
|
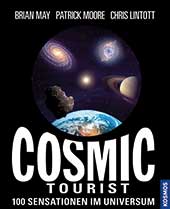
|
Brian May, Patrick Moore & Chris Lintott:
Cosmic Tourist. 100 Sensationen im Universum.
Gebundene Ausgabe: 192 Seiten
Verlag: Franckh Kosmos Verlag; Auflage: 1 (8. Oktober 2012)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3440134253
ISBN-13: 978-3440134252
Preis: 14,99 Euro
|

|
Douglas Adams:
Per Anhalter durch die Galaxis.
Taschenbuch: 208 Seiten
Verlag: Heyne (2009)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3453146972
ISBN-13: 978-3453146976
Preis: 8,99 Euro
|
Bücher über Astrobiologie, Weltall, Sternbilder & Evo-Fiction
Galaktische Schnirkelschnecken: bitte melden!
Sind wir allein im All? Lebensfreundliche Planeten gäbe es in Massen, bloß scheint dort niemand zu wohnen. Oder sind wir den Aliens vielleicht bloß schnuppe?
Im Weltall geht’s zu wie in der Münchener Fußgängerzone drei Tage vor Weihnachten: Betrieb, Hektik und Getümmel allerorten. Allein in unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, soll es – halten Sie sich fest! – zehn Milliarden bewohnbarer Planeten geben. Zehn! Milliarden!! Bewohnbarer!!! Planeten!!!! Zumindest verkündeten dies drei NASA-Wissenschaftler Anfang November 2013 in ihrer Hauspostille Proc. Natl. Acad. Sci. USA (Erik Petigura et al.: Prevalence of Earth-size planets orbiting Sun-like stars. doi: 10.1073/pnas.1319909110).
Wie Erik Petigura und seine Kollegen vom California Institute of Technology (Caltech) darauf kommen, dass es mehr Planeten mit lebensfreundlichen Bedingungen gebe als derzeit Menschen auf der Erde? Ganz einfach: Sie nutzten die in vier Jahren erhaltenen Daten des Kepler-Weltraumteleskops. Dieses 600 Millionen Dollar teure Himmelgucker-Spielzeug umkreist seit 2009 die Sonne, dabei fix auf 190.000 Sterne im Sternbild Schwan ausgerichtet, um dort auffällige Helligkeitsschwankungen festzustellen. Diese Schwankungen lassen sich in manchen Fällen damit erklären, dass ein für uns „unsichtbarer“ Planet vor seinem Heimatstern vorüberzieht und diesen dabei minimal abdunkelt – et voilà: schon ist ein weiterer Trabant entdeckt.
Die Astronomen pickten sich 42.000 sonnenähnliche Sterne heraus und identifizierten in deren Nähe 603 Planetenkandidaten – zehn davon ähnlich groß wie die Erde, dazu mit Gesteinsoberfläche und einer „moderaten“ Umlaufbahn, welche flüssiges Wasser und damit die Grundvoraussetzung für Leben erlauben würde. Mit einer selbst entwickelten Simulations-Software schätzten sie anschließend ab, wie viele Planeten das Kepler-Teleskop „übersieht“ beziehungsweise nicht findet – und errechneten daraus die mutmaßliche tatsächliche Zahl erdähnlicher Planeten, die um sonnenähnliche Sterne kreisen.
Gänsehaut-machende Hochrechnung
Die Ergebnisse sind mehr als spektakulär – sie machen Gänsehaut: Offenbar besitzen rund 22 Prozent aller sonnenähnlichen Sterne einen Trabanten in Erdgröße und erdähnlicher Umlaufbahn, der somit die Existenz flüssigen Wassers erlaubt. Hochgerechnet allein auf unsere Heimatgalaxie wären das die eingangs genannten zehn Milliarden Planeten. Jedes fiktiv-optimistische Szenario einer wie immer gearteten „planetarischen Föderation“ à la Star Trek verblasst angesichts dieser Unmengen potenziell belebter Biosphären. Die erdnächste davon liegt rein statistisch nicht mehr als zwölf Lichtjahre von uns entfernt, hat der erwähnte Caltech-Forscher Petigura errechnet. Dieser hypothetische erdähnliche Planet sollte seine Bahn also entweder um Alpha Centauri (4,3 Lichtjahre von uns entfernt) oder um Tau Ceti (11,9 Lichtjahre) ziehen.
Treffer in unmittelbarer Nachbarschaft
In der Tat besitzt letzterer einen Planeten in der habitablen Zone, was Petiguras Modell stützt – Tau Ceti e, mit der vierfachen Erdmasse und einer Umlaufzeit von 168 Tagen. Entdeckt wurde er bereits 2012. Das voraussichtlich 2024 in Chile in Betrieb gehende „Extremely Large Telescope“ der Europäischen Südsternwarte – das dann weltweit größte optische Teleskop – soll auf ihm nach atmosphärischem Wasser und lebensfreundlichen Temperaturen suchen. Wäre doch fantastisch für jeden Biologen, wenn sich in unserer nächsten Nachbarschaft ein Wohngebiet für exotische Aliens befinden würde, nicht wahr?
Es ist nicht das erste Mal: Schon 1960 hofften Astronomen um Frank Drake aus dem Tau-Ceti-System künstliche Signale von etwaigen Außerirdischen zu erlauschen. In ihrer 200 Stunden währenden Suche fanden sie jedoch: nichts. Auch alle anderen Versuche seither, irgendwelche Spuren technologisch versierter Fremdlinge zu erlauschen, schlugen fehl.
Schnirkelschnecken: auch im All?
Die Suche nach Leben jenseits unseres Heimatplaneten wird gerne belächelt oder gar kritisiert. Man habe hier unten auf der Erde doch wirklich genug Probleme: Bürgerkriege, Klimaerwärmung – ganz zu schweigen von Verspätungen im Reiseverkehr der Deutschen Bahn. Was müsse man da auch noch mit Milliardenaufwand nach hypothetischen Grünen Männchen suchen? Das sei Realitätsflucht und Geldverschwendung.
Doch mit dem exakt gleichen Argument könnte man auch kritisieren, dass Biologen seit Jahrhunderten unseren Planeten nach unentdeckten Spezies durchstöbern. Welche Relevanz für unser tägliches Leben haben die Gefleckte Schnirkelschnecke oder der Rotmäulige Walkopffisch (Rondeletia loricata)? Keine. Ungeachtet dieser offensichtlichen Nutzlosigkeit hat der geistig durchaus fitte Japaner Tokiharu Abe 1963 R. loricata eingehend untersucht und beschrieben. War Abe denn verrückt?
Nein – es liegt schlicht in der Natur der Wissenschaft und des Menschen, nach den Eigenschaften und Gesetzmäßigkeiten der Natur zu suchen.
Seit Giordano Bruno im 16. Jahrhundert postulierte, dass es unendlich viele Lebewesen auf anderen Planeten im Universum gebe, haben sich Naturwissenschaftler auch zunehmend, zunächst philosophisch, der extraterrestrischen Regionen angenommen. Der Astronom Christiaan Huygens etwa vermutete, „daß die Planeten nicht weniger geschmükt und bewohnet seyn, als unsere Erde“; Immanuel Kant thematisierte 1755 in „Von den Bewohnern der Gestirne“, ob es Leben auf anderen Planeten gebe; und Percival Lowell mutmaßte 1895, dass angebliche „Marskanäle“ die Artefakte einer längst vergangenen Zivilisation seien.
Zumindest unser Sonnensystem scheint außerhalb der irdischen Stratosphäre jedoch frei von höherem Leben zu sein. Außerhalb der Heimat von Mensch, Schnirkelschnecke und Walkopffisch beherbergt es wohl höchstens extraterrestrische, extremophile Bakterien – und selbst die harren weiterhin ihrer Entdeckung. Theoretisch könnte auf den Planeten Venus und Mars sowie auf einigen Jupiter- und Saturnmonden aber durchaus primitives Leben existieren.
Bauer sucht Frau im All
Ganz anders sieht es weiter draußen aus – siehe oben: zehn Milliarden habitable Möglichkeiten. Wieso aber ist es dort so nervtötend-einsam; warum haben sich die Aliens noch nicht bei uns gemeldet? Liegt es an unserer terrestrischen Randlage? Im galaktischen Maßstab kreiselt unser irdisches Sonnensystem dort, wo sich der Große und der Kleine Wagen gute Nacht sagen: 27.000 Lichtjahre vom galaktischen Zentrum entfernt, im komplett unwichtigen Orion-Arm der Milchstraße im kümmerlichen Restfurz einer vor Millionen Jahren explodierten Supernova.
Dessen ungeachtet hätten außerirdische Spezies Zeit genug gehabt, interstellare Botschaften auch in den hintersten Winkel des Alls zu schicken: Die ersten Sterne unserer Galaxie entstanden bereits vor rund 13,5 Milliarden Jahren, also unmittelbar nach dem Urknall. Da es bekanntermaßen nur rund 4,5 Milliarden Jahre dauert, ehe sich auf einem Planeten von Erdgröße eine fortschrittliche Zivilisation bildet, die „Bauer sucht Frau“ ins Weltall senden kann (und weitere 6,5 Milliarden Jahre, ehe die Sonne zur Planeten-zerstörenden Nova wird), sollte es in der Milchstraße geradezu wimmeln von Alien-Raumschiffen und extraterrestrischen TV-Shows.
Allein: Totenstille da draußen. Wo sind die bloß alle? Sind wir Erdlinge denen zu langweilig? Oder zu spießig? Haben sich all die Vulkanier, Wookiees, Zylonen und Dracs schon vor Äonen in grausamen Atomkriegen vernichtet, oder haben sie eine höhere Bewusstseinsstufe erlangt und durchfluten als körperlose Wesen den Kosmos?
Die letzten – und die ersten
Der englische Autor Olaf Stapledon (1886-1950) hat in seinem 1930 erschienenen Science-Fiction-Klassiker Die letzten und die ersten Menschen skizziert, wie die Geschichte einer intelligenten Spezies (hier: der Menschheit) in einem Zeitraum von zwei Milliarden Jahren aussehen könnte. Er beschrieb, wie unsere Nachkommen aus einer Notlage heraus auf den Nachbarplaneten Venus auswandern (und dabei die dort lebenden Meeresbewohner ausrotten), allmählich den Weltraum erobern, mittels natürlicher Evolution und auch künstlichem Genetic Engineering immer neue körperliche Merkmale und Eigenheiten entwickeln und schließlich das ganze Sonnensystem bis zum Neptun kolonisieren.
Stapledons berühmtester Roman, der Ende letzten Jahres in einer schmucken Sammler-Edition bei Piper neu aufgelegt wurde, und die darin dargestellten Konzepte der natürlichen und (bio)technologischen Evolution des Menschen haben das Genre der Science-Fiction maßgeblich geprägt. Filmreihen wie Star Trek und Krieg der Sterne sind von ihm inspiriert. Doch auch wenn Stapledon im Grunde eine positive Evolution in Richtung größerer Weisheit beschreibt, wird die Spezies Mensch immer wieder durch entsetzliche Kriege, religiöse Irrwege und Rohstoffknappheit in Barbarei und Unmenschlichkeit zurückgeworfen.
So richtig voran geht es also nicht mit uns, weder verstandesmäßig noch technologisch – nicht mal in den absurd langen Zeiträumen, in denen Stapledon seine Geschichte ablaufen lässt. Und dies ist zugleich auch die zentrale Kritik des Rezensenten am Szenario des englischen Autors: Dass sich nach globalen Katastrophen und hunderten von Millionen Jahren jedes Mal wieder ausgerechnet Homo sapiens als vorherrschende Art durchsetzt und ein weiteres Mal die Weltherrschaft erringt, darf stark bezweifelt werden.
Durchs All mit dem Rockstar
Wer sich mangels realer Möglichkeiten zumindest fiktiv auf die Suche nach extraterrestrischen Lebensformen machen möchte, kann eine Sternkarte zur Hand nehmen und sich nächtens auf die Suche nach dem Sternbild des Orion machen. Darin findet sich unter anderem der siebthellste Stern des Nachthimmels, der Rigel, etwa 770 Lichtjahre entfernt und zumindest im Star-Trek-Universum das am dichtesten besiedelte Sternensystem im bekannten Weltraum. Die Nachtleuchtende Sternkarte für Einsteiger aus dem Kosmos-Verlag ist kinderleicht zu bedienen und macht sie mit dem Nachthimmel und dessen 88 von der Astronomischen Union anerkannten Sternbildern vertraut.
Oder Sie machen es sich auf dem heimischen Sofa mit dem auf Hochglanzpapier gedruckten und prächtig illustrierten Bildband Cosmic Tourist bequem. Zu den drei Autoren dieses intergalaktischen Reiseführers gehört der promovierte Astronom Brian May, besser bekannt als Gitarrist der Rockband Queen und Urheber des Mitgröhl-Popsongs „We Will Rock You“. Zusammen mit der britischen BBC-Legende Patrick Moore („The Sky at Night“) und dem Galaxienforscher Chris Lintott durchstreift er als fiktiver Pilot eines „gedankenschnellen Raumschiffs“ das All und besichtigt dabei „hundert außergewöhnliche Orte“ in ebensovielen Kapiteln – beginnend auf der Erde am Mond vorbei und durchs Sonnensystem hindurch in immer größer werdenden Schritten bis zum Horizont des Universums, 13 Milliarden Lichtjahre entfernt.
Promotion 38 Jahre später
May, der seine Promotion am Imperial College London 1974 unterbrach, als Queen zunehmend internationale Erfolge feierte, nahm seine astrophysikalischen Arbeiten ab 2006 wieder auf und erhielt im Mai 2008 – 38 Jahre nachdem er sie begonnen hatte – die Doktorwürde verliehen. Das Thema von Mays Dissertation ist übrigens das Zodiakallicht – an winzigen Staubteilchen gestreutes Sonnenlicht – und natürlich taucht es im betreffenden Bildband auch auf einer Doppelseite auf.
So beeindruckend die verwendeten Fotos vor schwarzem Hintergrund aber auch wirken: Douglas Adams’ Vater aller interstellaren Reiseführer, Per Anhalter durch die Galaxis, ist um Welten kurzweiliger (und bietet dazu eine Menge extraterrestrischer Spezies). Auch Brian Mays Song 39 (vom 1975er-Queen-Album A Night at the Opera) geht einem irgendwie näher. Er thematisiert darin die depremierende Tatsache, dass mit Beinahe-Lichtgeschwindigkeit reisende Astronauten dank Einsteins Spezieller Relativitätstheorie bei ihrer Rückkehr zur Erde keine ihnen bekannten Menschen mehr treffen würden.
Weit, weit weg
Auch die Raumfahrt-Bewerber, die im Rahmen des umstrittenen „Mars One“-Projekts eine Reise zum roten Nachbarplaneten unternehmen wollen, könnten nie mehr auf die Geburtstagsparties ihrer Freunde gehen, allerdings aus anderen Gründen: Sie verzichten freiwillig darauf. Die gleichnamige Stiftung möchte 2027 zwei dutzend Raumfahrer auf den Mars schicken, um dort eine dauerhafte menschliche Besiedlung zu etablieren (siehe Abbildung auf Seite 64). Der Flug soll sieben Monate dauern – und keine Rückkehrmöglichkeit bieten. Dennoch soll es tausende von Bewerbern geben.
Wieso aber nicht gleich richtig dicke Bretter bohren und zum mutmaßlich bewohnbaren Planeten Tau Ceti e reisen? Wie lange würde das denn dauern?
Die bislang schnellsten von Menschenhand geschaffenen Raumschiffe – die beiden litfaßsäulengrößen Helios-Raumsonden zur Erforschung der Sonne – rasten Mitte der 1980er Jahre mit rund 250.000 Kilometern pro Stunde durchs All. Bis zum 11,9 Lichtjahre entfernten Tau-Ceti-System und dessen Planeten würden sie in diesem Schneckentempo rund 51.000 Jahre brauchen.
Tja, liebe Leser – mal schnell hinfliegen und nachschauen ist also vorerst nicht. Wir müssen weiterhin die neuesten Star-Wars-Schmonzetten ertragen und danach über fiktive wie mutmaßlich reale Aliens und Grüne Männchen spekulieren; dazu unsere radioteleskopischen Lauscher auf die Suche nach fremden Signalen ins All richten und im besten Fall Mars und Venus besiedeln – ganz so wie es Olaf Stapledon bereits 1930 vorgeschlagen hat.
Letzte Änderungen: 02.03.2016