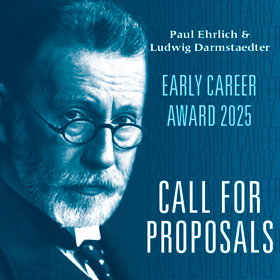Buchbesprechung
Sigrid März

|
Gottfried Schatz:
Jenseits der Gene – Essays über unser Wesen, unsere Welt und unsere Träume.
Gebundene Ausgabe: 184 Seiten
Verlag: Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro; Auflage: 3., Aufl. (Januar 2011)
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 3038237000
ISBN-13: 978-3038237006
Preis: 24,90 Euro
|
Das Staunen nicht verlernen
Ein kleines, feines Büchlein vom kürzlich verstorbenen Erforscher der Mitochondrien.
„Noch nie hatte ich so gefroren“, schildert Gottfried Schatz einen prägenden Eindruck seiner Flucht vor den Kriegswirren. Und er staunt über die Wärme, die sein Sitznachbar ausstrahlt; ausreichend Energie, um auch ihn, den jungen Flüchtling aus Österreich im eiskalten Zugabteil, zu wärmen. Eine Geschichte über die Flucht vor dem Zweiten Weltkrieg? Weit gefehlt. Denn alsbald erzählt der renommierte Wissenschaftler von den kleinen Kraftwerken in jeder Körperzelle, die eben diese Energie erzeugen: den Mitochondrien, oder „Würmchen“, wie Schatz sie fast liebevoll nennt. Sie sind sein Schicksal, so scheint es, forschte er doch jahrzehntelang an den für die Zellatmung verantwortlichen Organellen und gilt nicht ohne Grund als Mitochondrien-Pionier. Im Essay ‚Fremde in mir‘ erläutert er die Vorteile der Zellatmung, die Evolution frühen irdischen Lebens und die Endosymbiontentheorie: „Ich bin der ferne Nachfahre einer Vereinigung zweier verschiedener Lebewesen vor 1,5 Milliarden Jahren [...].“
Diese Ehrfurcht vor der Welt, dem Leben und der Existenz per se zieht sich wie ein roter Faden durch die Kurztexte des österreichisch-schweizerischen Biochemikers. Die Naturwissenschaft alleine reichte ihm nicht, um seine Fragen zu beantworten. Und so wagte Schatz immer wieder einen Blick nach rechts und links, in die Literatur, die Kunst (er spielte unter anderem an der Wiener Volksoper Geige) und die Philosophie. Seit 2006 schrieb er für die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) zahlreiche Artikel, von denen er einige in der Erstauflage von Jenseits der Gene im Jahre 2008 veröffentlichte. 2012 wurde diese Essaysammlung bereits zum vierten Mal aufgelegt. Auch weitere Sammlungen seiner Kurztexte gibt es in Buchform. Den Schritt in ein für ihn neues literarisches Terrain, den Roman, wagte er jedoch erst 2015 mit Postdoc. Im gleichen Jahr verstarb Schatz im Alter von 79 Jahren in Basel an einer schon länger andauernden Krebserkrankung.
Getrieben von Neugierde
Getrieben von kaum zu stillender Neugierde grübelte der Wahlschweizer zeitlebens nicht nur über wissenschaftlichen Problemen, sondern auch über der Frage nach dem ‚Warum‘? Offenbar plagten ihn Selbstzweifel, er fühlte sich klein und unvollkommen: „Ich weiß so wenig von der Welt, die mich umgibt – und jede Frage zeigt mir aufs Neue die engen Grenzen meiner angeborenen Sinne.“ In etlichen der 20 Essays beschäftigt sich Schatz folglich mit den menschlichen Sinnen: Riechen, Tasten, Sehen, Hören, Schmecken. Gleich einem Kind vor dem Spielzeugladen staunt er mit großen Augen ob der enormen Fähigkeiten und der perfekten Anpassung der Sinne an ihre Anforderungen. Mit einem vergleichenden Blick in die Tierwelt verzweifelt Schatz aber bereits im nächsten Absatz an der sinnlichen Unvollkommenheit und – noch schlimmer – an ihrer unaufhaltsamen Vergänglichkeit.
Die meisten seiner Essays erschienen ursprünglich in der NZZ, wohlgemerkt im Feuilleton, nicht im Wissenschaftsteil. Und wenngleich viel Wissenschaft in jedem seiner Artikel steckt – feinste Details und tiefgründige Erklärungen – so überwiegt doch das Spiel mit Worten sowie der offensichtliche Spaß an poetischer Sprache. Die Texte fließen elegant, die Wortwahl ist stellenweise mondän, die Sprache reich an Bildern.
Mykobakterien beispielsweise werden personifiziert; sie bekommen ein Gesicht, einen Charakter und einen Willen. Zugegeben, dies ist wenig schmeichelhaft, bezeichnet Schatz die Erreger von Tuberkulose und Lepra doch als „das mörderische Brüderpaar.“
Man mag sich hinreißen lassen, dem „großen Bruder“ Mycobacterium tuberculosis Grausamkeit und Gewissenlosigkeit zu unterstellen, rafft er doch auch heute noch Jahr für Jahr unzählige Menschen dahin. Und das einzige Ziel des bakteriellen Al Capone ist es, den erfindungsreichen Menschen mit ihren Medikamenten immer einen Schritt voraus zu sein. Dabei kann es sich auf seine anpassungsfähige genetische Ausstattung verlassen. „Der grausame kleine Bruder“, wie Schatz Mycobacterium leprae betitelt, tötet mit seiner wenig variablen „genetische[n] Schrotthalde“ subtiler, langsamer und umso hinterhältiger. „Er macht seine Opfer zu Ausgestoßenen – zu lebenden Toten.“ Der Leser spürt Schatz‘ Zwiespalt: Faszination, ja fast Bewunderung ob dieser so unterschiedlichen und dennoch jeweils erfolgreichen Taktiken einerseits – und andererseits Abscheu und Hilflosigkeit angesichts der vielen Kranken und Toten.
Wissbegierde als „Waffe“
Man hält kurz inne, fragt nach dem ‚Warum‘ und folgt Schatz dann auf weitere Exkurse vom Element Eisen bis zu vollsynthetischen, hochkomplexen Werkstoffen, vom elementaren Licht bis zum unerklärlichen Klimawandel und von der zirkadianen Körperuhr bis zu Parasitismus und Genetik. Bunt ist die Themenvielfalt, und sie spiegelt die umfassende Allgemeinbildung des philosophischen Wissenschaftlers wider, der doch nur begreifen und lernen wollte:
Die Waffe der Wissenschaft ist Wissbegierde – doch diese Waffe ist stumpf ohne die Schärfe der Intelligenz. Aber selbst die schärfste Intelligenz ist kraftlos ohne Leidenschaft und Mut – und diese wiederum sind Strohfeuer ohne die Macht der Geduld.
Letzte Änderungen: 30.01.2016