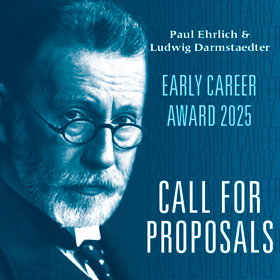Multiomics (Multi-Omik)
von Melanie Erzler (Laborjournal-Ausgabe 3, 2019)
Das Ausmaß biomedizinischer Daten, die erfass- und auswertbar sind, wächst mit dem technologischen Fortschritt lawinenartig. Betrachtete man zunächst nur einzelne krankheitsassoziierte Gene, erlauben etwa Genome-Wide Association Studies (GWAS) heute den Blick auf das komplette Genom. Sie ermöglichen die Detektion von Gen-Varianten, die womöglich mit Krankheitsursachen, -prognose und Therapieerfolg zusammenhängen könnten.
Doch es bleibt nicht bei den Genomics – die ganze Omics-Familie wächst schon längere Zeit stetig weiter: Epigenomics erlaubt eine genomweite Charakterisierung reversibler und häufig gewebespezifischer Modifikationen von DNA- oder DNA-assoziierten Molekülen, beispielsweise Methylierungen. Die qualitative und quantitative Auswertung von RNA gibt in Form von Transcriptomics Auskunft über die Genexpression. Weiterführend analysieren die Proteomics die Verbreitung, Modifikation und Interaktion verschiedener Peptide, während Metabolomics den Fluss von Stoffwechselprodukten wie Amino- oder Fettsäuren betrachten. Nicht unerwähnt bleiben dürfen natürlich die Microbiomics, die vor allem wegen der vermeintlichen Bedeutung des Darm-Mikrobioms von steigendem Interesse sind.
Die „noch größere Nummer“
Doch auch bei den Omics allein soll es nicht bleiben: Kombiniert man deren einzelnen Output, landet man bei einer noch größeren Nummer – den Multiomics, oder der Multi-Omik. Und naturgemäß erweitert diese nochmals unseren Blick auf größere Zusammenhänge und Informationsflüsse im gesunden und im kranken Körper.
Daniela Strenkert et al. (PNAS 116 (6): 2374-83) betrachteten mithilfe eines Multiomics-Ansatzes beispielsweise, wie die molekularen Abläufe in der Grünalge Chlamydomonas reinhardtii vom Tag-Nacht-Rhythmus abhängen. Indem sie parallel Daten zum Transkriptom, zu Metaboliten und Proteinen wie auch physiologische Parameter erfassten, konnten sie auf metabolische Ereignisse in der Alge schließen und den Einfluss des Transkriptoms auf das Proteom untersuchen. So clusterten etwa Gene, die in ähnliche zelluläre Funktionen involviert waren, in Abhängigkeit vom zirkadianen Rhythmus.
Mithilfe der Multiomics kann man also molekulare Muster erkennen und Netzwerke erstellen. In Zeiten, in denen immer klarer wird, dass gerade die großen Volkskrankheiten multifaktoriell und nicht monogen bedingt sind, bietet dieser ganzheitliche Ansatz womöglich einen wichtigen Mehrwert.
Auf verschiedenen Wegen
Eine konkrete Multiomics-Analyse kennt dabei unterschiedliche Herangehensweisen. „Genome first“ startet klassisch auf Basis der DNA: Mittels GWAS assoziiert man Genvarianten mit Krankheiten und sucht nach Mechanismen, wie diese die Erkrankungen verursachen. Allerdings ist es schwer, ursächliche Genvarianten exakt zu lokalisieren sowie davon betroffene Signalwege oder gar Zielstrukturen für Therapien zu erkennen. Hier hilft nun die Integration von Transcriptomics- und/oder Proteomics-Daten.
Der „Phenotype-first“-Ansatz hingegen sucht nach Korrelationen verschiedener Omics-Daten mit einem bestimmten Phänotyp, um aus dem sich ergebenden Bild auf betroffene Signalwege zu schließen. Auf dem „Environment first“-Weg wird untersucht, inwiefern sich Umwelteinflüsse wie Ernährung oder Stress auf Signalwege auswirken, mit bestimmten Phänotypen korrelieren oder mit genetischen Varianten zusammenspielen.
Kausal, oder nur Korrelation?
Eine besondere Herausforderung für die Statistik besteht bei alledem darin, kausale von korrelativen Zusammenhängen zu unterscheiden. Bei den Genomics ist das nicht so schwer – man geht davon aus, dass genetische Veränderungen ursächlich am Anfang stehen, nahezu unveränderlich sind und gewisse Folgeprozesse nach sich ziehen. Bei den anderen Omics fällt die Assoziation hingegen nicht so leicht – gute statistische Werkzeuge sind deshalb unabdingbar.
Lernen an Datensätzen
Eine neue Integrationsmethode publizierten Hossein Sharifi-Noghabi et al. kürzlich auf bioRXiv (DOI: 10.1101/531327). Ihre auf künstlichen neuronalen Netzwerken basierende „Multi Omics Late Integration Method“ (MOLI) entwickelten sie, um Therapien dadurch zu verbessern, dass die Medikamentantwort präziser vorausgesagt werden kann und somit die klinische Relevanz erhöht wird. Die „Late Integration“ bezieht sich dabei auf die Art des Lernens: Statt an allen zugleich lernt MOLI zuerst an den einzelnen Omics-Datensätzen – und integriert diese im Anschluss. Die kanadischen Forscher kombinierten hierzu Daten über somatische Mutationen, Copy Number Variations (CNV) sowie über die Genexpression aus frei zugänglichen Datensätzen verschiedener Zelllinien und Patientenproben.
Teamgeist zwingend notwendig
Die MOLI-Methode kann mithilfe zusätzlicher Datensätze weiter optimiert werden. Standen beispielsweise Daten zu mehreren Therapeutika mit demselben Target (hier: verschiedene EGFR-Inhibitoren) zur Verfügung, resultierte eine höhere Präzision, als wenn nur ein Medikament analysiert wurde. Die Autoren sprechen hier von Transferlernen.
Die Multiomics fordern aber nicht nur die Statistik heraus – auch der Wissenschaftler als Teamplayer ist gefragt: Erfassung, Handling und Analyse der für Multiomics benötigten Datensätze schafft keine Arbeitsgruppe allein. Unabdingbar sind Kooperationen und Austauschmöglichkeiten, um die Einzelteile zu einem großen Ganzen zusammenzufügen. Dafür ist ein allgemeingültiger Standard nötig – genauso wie die Bereitschaft, seine Daten mit anderen Forschern zu teilen.
Letzte Änderungen: 08.03.2019