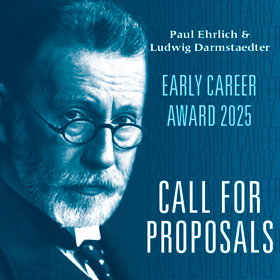Sonocytologie
von Julia Schlehe (Laborjournal-Ausgabe 09, 2004)
Hefezellen singen Sopran – wenn sich zwei Kalifornier nicht irren. James Gimzewski, Chemiker an der University of California in Los Angeles (UCLA) und sein Doktorand Andrew Pelling fanden Hinweise darauf, dass Hefezellen Töne von sich geben (Nature 423, 106-107).
Die Idee, Zellen zu belauschen, kam Gimzewski 2001 im Gespräch mit dem italienischen Herzforscher Carlo Ventura, wie er dem Magazin LA Weekly (Bd. 10, 2003) berichtete. Ventura erzählte ihm, dass Herzstammzellen in der Zellkultur pulsieren. Gimzewski, der sich bisher eher mit physikalischen als mit biologischen Fragen befasste, überlegte sich daraufhin, dass diese Zellen auch Geräusche von sich geben müssen: Eine vibrierende, pulsierende Oberfläche erzeugt in der sie umgebenden Luft Druckwellen, also Schall. Und dieser Schall müsste sich bei genügender Verstärkung hörbar machen lassen.
Für eine solche Aufgabe ist Gimzewski, eine anerkannte Größe auf dem Gebiet der Nanotechnologie, wohlgerüstet: Der vielfach preisgekrönte Experte für die Chemie und Physik einzelner Moleküle leitete jahrelang eine Forschungsgruppe bei IBM in Zürich, wo er spektakuläre Bilder von Molekülen mit Hilfe von Rastertunnelmikroskopen und Rasterkraftmikroskopen aufnahm. Zudem stellten er und sein Team eine Reihe von Nanomaschinen her, zum Beispiel einen 1,5 nm großen Propeller und den kleinsten Abakus der Welt aus Fulleren-Kugeln.
Mit Feder und Laser
Um die Zellschwingungen an Hefezellen zu messen, funktionierten die Kalifornier ein Rasterkraftmikroskop zu einer Art Plattenspieler um: normalerweise verwendet man das Rasterkraftmikroskop, um Oberflächen von Zellen oder auch Molekülen darzustellen. Dabei tastet eine feine Spitze die Oberfläche einer Probe zeilenweise ab. Die Spitze ist an einer Blattfeder befestigt, auf die ein Laserstrahl gerichtet ist. Dieser wird an ihr reflektiert und von einer Photodiode detektiert. Jede Verbiegung der Blattfeder, die durch das Auf und Ab der Spitze verursacht wird, kann so gemessen werden. Um nun die Schwingungen von Zellen zu messen, ließen Gimzewski und Pelling die Spitze auf einer Stelle, anstatt sie auf der Zelle hin und her zu bewegen.
Doch nur Nebengeräusche?
Ihre Messungen ergaben tatsächlich, dass eine lebende Hefezelle vibrierte, und zwar mit einer Amplitude von 3 nm und einer Frequenz von 1000 Hz. Das entspricht ungefähr einem zweigestrichenem Cis und einer wesentlich schnelleren Vibration, als die Forscher erwartet hatten. Sie verstärkten den Ton so weit, dass er für menschliche Ohren vor einem Hintergrundrauschen hörbar ist. Als Kontrolle überprüften Gimzewski und Pelling eine tote Zelle: sie gab keinen Ton von sich. Behandelten sie dagegen lebende Zellen mit Isopropanol, dann "qietschen" sie wesentlich höher als eine normale Hefezelle. Gimzewski gab dem Kind umgehend seinen Namen: Sonocytologie.
Ob die Töne, die die Kalifornier detektieren, wirklich von den Zellen stammen, ist aber nicht gesichert. Sie geben zu, dass die Vibrationen auch aus der die Zelle umgebenden Flüssigkeit oder der Mikroskopspitze selbst kommen könnten. Aber sie arbeiten daran, diese Quellen auszuschließen: Pelling und Gimzewski haben das Rasterkraftmikroskop in einem eigenen Raum untergebracht. Es steht pneumatisch gefedert in einem mit Folie ausgekleidetem Gehäuse, um es gegen Erschütterungen und elektromagnetische Felder abzuschirmen. Bei den Messungen ist das Gehäuse geschlossen, keiner ist im Raum, das Licht ist ausgeschaltet und die Tür ist zu.
Ihre Ergebnisse sind gerade in Science erschienen (Bd. 305, S. 1147). Diskutiert wurde in der Presse indes schon vorher. Hermann Gaub von der Angewandten Physik der LMU München vermutete etwa im Smithsonian Magazine (03/2004), dass der Ton, den die Kalifornier hören, andere Quellen hat. Wenn die Geräuschquelle aber wirklich in der Zelle läge, so wäre dies "revolutionär, spektakulär und unglaublich wichtig", so Gaub.
Der Neurobiologe und Biophysiker Ratnesh Lal von der University of California in Santa Barbara, der die Elastizität von pulsierenden Herzzellen mit dem Rasterkraftmikroskop untersucht hat (Am J Physiol. 269, C286-92), meint, dass Gimzewskis Erfahrung bei dieser Frage den Ausschlag geben könnte: "Wenn es jemanden auf der Welt gibt, der so was machen kann, dann er."
Die Beobachtung, dass genetisch verschiedene Hefestämme Töne in unterschiedlichen Höhen hervorbringen, rief schließlich den Krebsforscher und Pathologen Michael Teitell von der University of California in Los Angeles (UCLA) auf den Plan. Jetzt beseelt die Forscher die Hoffnung, die Zellmusik einmal in der Krebsdiagnostik anwenden zu können, um Krebszellen von gesunden zu unterscheiden. Der Diagnostik-Traum geht gar dahin, Krebs bereits in seinen frühesten Stadien am Klang erkennen zu können. Doch bei allem Forscherdrang bleibt auch Teitell vorsichtig: "Es könnte sich herausstellen, dass die Signale so ein Durcheinander sind, dass wir sie nicht eindeutig identifizieren können."
Bereits jetzt schon Kunst
Auch wenn der Einsatz in der Medizin folglich noch in weiter Ferne steht – auf völlig anderem Gebiet gibt es angewandte Sonocytologie bereits: Pelling schuf zusammen mit der Medienkünstlerin Anne Niemetz das Werk "The Dark Side of the Cell", das seit Juni 2004 auf der interdisziplinären Ausstellung NANO in Los Angeles zu bewundern ist. Der Forscher und die Künstlerin haben dazu eine Komposition aus den aufgezeichneten Zelltönen kreiert, die dort im Rahmen einer Installation aufgeführt wird.
(Die "singenden" Hefezellen sind zu hören auf den Internetseiten von James Gimzewski unter: http://www.chem.ucla. edu/dept/Faculty/gimzewski/teapot/)
Letzte Änderungen: 20.10.2004