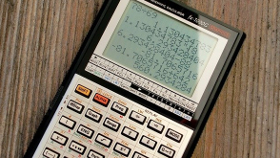Nützlich, lästig, idealisiert
(24.11.2020) Mathematische Modelle können die komplexe Biologie oftmals sinnvoll vereinfachen. Der Blick über den Tellerrand lohnt sich also.
„Mathematik für Biologen und Mediziner“ – so oder ähnlich heißt manch eine Pflichtveranstaltung der ersten Semester. Nicht für alle Studierenden sind die zugehörigen Vorlesungen, Übungen und Klausuren die reinste Freude. Andererseits flirtet die Biologie spätestens seit dem 19. Jahrhundert mit der Mathematik. Mal als schlichtes Werkzeug für die statistische Auswertung – mal, um wunderbar elegante Modelle zu liefern. Und heute, in Omics-Zeiten, ist eine Biologie ohne Mathematik gar nicht vorstellbar. Manchmal, weil es einfach keine Alternative gibt beim Umgang mit der Datenflut, manchmal aber auch, weil die Modellierer echte Wege zum Verständnis biologischer Prinzipien anbieten können.
Vereinfachung ist also erwünscht. „Das ist etwas, womit Biologen oft ein Problem haben“, stellt Philipp Messer als Quereinsteiger aus der Physik fest. Denn je näher ein Modell der Realität kommt, desto mehr Annahmen fließen dort ein. Grundprinzipien verschwinden dann hinter der Komplexität – und letztlich braucht man das Modell gar nicht, weil man dann auch gleich direkt ins natürliche System schauen kann. „Genau das ist die ewige Herausforderung“, erklärt Messer, der an der Cornell University eine Arbeitsgruppe zum Thema Evolutionsbiologie und Populationsgenetik leitet, und fragt: „Für welche Vorhersagen macht es überhaupt Sinn, einen Spezialfall zu berücksichtigen? Und würde dieser Spezialfall wirklich die grundlegenden Vorhersagen ändern?“
Historische Grundsteine
Historisch ist die Mathematik den Biologen gar nicht so fremd, wie man meinen möchte, legt Messer dar: „Die Populationsgenetik fing an als theoretische Wissenschaft.“ Ronald Fisher, Sewall Wright und John Haldane seien „die alten Herren dieser Disziplin“, die mit ihren Modellen zu Allelen in Populationen diploider Organismen wichtige Grundsteine legten. „Das sind Arbeiten aus den Zwanziger-, Dreißiger- und Vierzigerjahren des neunzehnten Jahrhunderts.“
Die Siebziger- und Achtzigerjahre seien dann geprägt gewesen durch die sogenannte neutrale Theorie der molekularen Evolution, eingeführt von Motoo Kimura. Hierbei geht man davon aus, dass die meisten Polymorphismen innerhalb einer Population weder vorteilhaft noch nachteilig sind. Mutationen sind also in der Regel neutral. „Allein rein zufällige Schwankungen bewirken, dass der eine Polymorphismus irgendwann verschwindet und ein anderer fixiert wird“, beschreibt Messer die Grundannahme und ergänzt, dass die neutrale Evolution bis vor rund 15 Jahren als das Paradigma der Populationsgenetik galt. „Mit diesem Modell konnte man wunderbar rechnen – doch lange Zeit gab es dazu überhaupt keine Daten!“
Mit der Revolution der Sequenziermethoden hat sich das aber geändert. „Jetzt können wir rausgehen und wirklich mal eintausend Genome aus einer Population sequenzieren“, freut sich Messer. Doch die Gendrift, also die Veränderung der Allelfrequenzen innerhalb einer Population, folgt eben nicht Kimuras Annahmen, wie der Blick auf die biologischen Daten zeigt. „Heute wissen wir, dass es viel komplizierter ist“, so Messer, „anscheinend wirkt doch viel mehr Selektion, als man gedacht hatte“.
Die interessanten Probleme
Auch Arne Traulsen ist eigentlich Physiker. Er leitet die Abteilung für Evolutionstheorie am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön. Offenbar sind es eher Physiker und Mathematiker, die den Weg an ein biologisch ausgerichtetes Institut finden als umgekehrt. „In der Biologie liegen schlichtweg die interessanten Probleme“, erklärt Traulsen.
Traulsens Expertise liegt in der Spieltheorie – einer Disziplin, die sich von jeher nicht um „Genre-Grenzen“ schert. Die Grundidee: Interaktionen zwischen zwei Individuen betrachtet man vereinfacht als ein Spiel. Einer kann gewinnen, der andere verlieren; es können aber auch beide Spieler mit Verlust oder beide mit Gewinn nach Hause gehen. Der Gewinn kann eine Futterressource, ein Paarungspartner oder Geld sein. Und jeder Spieler wählt eine bestimmte Strategie, die zum Beispiel kooperativ oder kompetitiv ist – oder bei mehreren Spielrunden auch nachtragend oder verzeihend sein kann.
Klar, dass sich auch Wirtschaftswissenschaftler und Psychologen in der Spieltheorie austoben. Und selbstverständlich ist das Feld von Mathematik geprägt. Doch da man Strategien auch so modellieren kann, dass sie als Allel codiert sind und sich weitervererben, kann das Spiel auch einfach um Fitness und somit die Anzahl der Nachkommen laufen. Und Nachkommen erben natürlich auch die Strategien ihrer Vorfahren – womit die Spieltheorie letztlich auch bei Evolutionsbiologen und Populationsgenetikern auf Interesse stößt.
Biologen beherrschen experimentelles Design
Nun könnte man die Physiker darum beneiden, dass sie in ihren Versuchen relativ leicht Störfaktoren ausschalten können. In der Biologie klappt das natürlich nicht. Doch Traulsen stellt klar: „Worin die Biologen extrem gut sind, das ist die Wissenschaft vom experimentellen Design.“ Kontrollversuche, doppelte Verblindung oder Placebogruppen dienen schließlich genau dazu, eine spezielle Variable zu isolieren. „Ein Physiker hingegen lernt im Studium eigentlich nicht wirklich, was eine Kontrolle ist.“
Traulsen legt aber ebenso Wert auf eine gewisse Eigenständigkeit der theoretischen Biologie. Auch wenn ein mathematisches Modell kein echtes biologisches System abbildet oder sich nicht experimentell überprüfen lässt, könne man daraus dennoch Erkenntnisse ableiten. „Man sollte den Mathematiker jetzt nicht stoppen, nur weil er der Biologie nicht mehr dient“, mahnt Traulsen. „Denn Wissenschaft ist mehr, als bloß Aktien zu kaufen, die gerade steigen.“
Das richtige Journal?
Wichtig sei es außerdem, seine Ergebnisse in den richtigen Fachblättern zu publizieren. Wer eine neue Erkenntnis zur Populationsgenetik in einem mathematischen Journal veröffentlicht, erreicht womöglich nicht die richtige Community. Andererseits sei es auch schon mal frustrierend, ein Paper speziell auf eine Zielgruppe hin auszurichten. „Die Biologen zwingen uns oft dazu, wirklich interessante Aspekte in die Supplements auszulagern“, bedauert Traulsen. Und auch innerhalb der eigenen Gemeinschaft der evolutionären Spieltheoretiker stößt nicht jede neue Idee gleich auf Begeisterung. „Gerade weil durch die Interdisziplinarität Erkenntnisse in der einen Disziplin grundlegend sein können, aber aus einer anderen Perspektive eher nebensächlich.“
Mario Rembold
Bild: Pixabay/STA82
Dieser hier gekürzte Artikel erschien in ausführlicher Form in Laborjournal 11/2020.