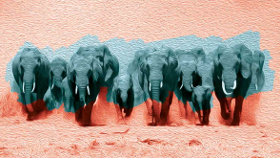Warum Präzisionswerkzeug, wenn wir doch ...
(14.07.2020) … den Presslufthammer haben? Zwei Jahre EuGH-Urteil zum Status genomeditierter Pflanzen – eine Idiotie setzt sich fort.
Nun ist das Urteil also schon zwei Jahre alt. Wer hätte gedacht, dass es uns so lange erhalten bleibt? Denn in seinem Urteil vom 25. Juli 2018 hat sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) in seiner Rechtsprechung zu gentechnisch veränderten Pflanzen (GVO) selbst übertroffen.
Grund genug, den zweiten Geburtstag dieses merkwürdigen Urteils zu feiern, indem man es in einem anschaulichen Bild darstellt. Stellt euch also ein Haus vor. Am besten so ein antikes tempelartiges Haus mit vielen Säulen. Damit unser antiker Tempel den modernen Anforderungen zur Barrierefreiheit gerecht wird, wollen wir im Eingangsbereich nun eine Säule entfernen, um einen breiteren Durchgang zu schaffen. Wir fragen also erstmal die Statiker. Die meinen, das sollte schon gehen, finden aber vor allem, wir sollen die Säule entfernen, während das Gebäude gesperrt ist – und wollen es sich danach noch mal sehr gründlich ansehen, bevor sie das Gebäude wieder zur Nutzung freigeben.
Das finden wir völlig in Ordnung und eigentlich sehr vernünftig.
Jetzt aber erklären uns die Baubehörden, dass wir zwei Möglichkeiten haben:
Alternative 1: Wir schneiden genau jene Säule, die wir entfernen wollen, mit präzisen Steinsägen einfach raus.
Alternative 2: Wir nehmen tausende Kopien des Hauses, stellen sie auf riesengroße Rüttelplattformen und bombardieren die Häuser zusätzlich aus der Luft. Dabei werden die Häuser an ziemlich vielen zufälligen Stellen beschädigt, und viele davon werden bestimmt in sich zusammenstürzen. Aber weil es so viele sind, werden wir am Ende vielleicht ein Haus darunter haben, bei dem genau die Säule fehlt, die wir loswerden wollten. Das müssen wir dann nur noch suchen und finden.
Und während wir uns noch gut überlegen, welche Vorgehensweise von beiden wohl die vernünftigere ist, klären uns die Behörden weiter über die rechtlichen Rahmenbedingungen auf. Sollten wir uns für Alternative 1 entscheiden, bliebe das Gebäude danach wohl noch etliche Jahre gesperrt, weil es unglaublich genau überprüft werden muss. Unter anderem wären wir verpflichtet zu zeigen, dass unser Gebäude ähnlich genug ist zu „konventionellen Gebäuden“ – oder zu solchen, die gerüttelt und bombardiert wurden. Außerdem müssen wir sehr gut kennzeichnen, dass wir hier Steinsägen verwendet haben, und müssen einen Plan vorlegen, wie das Gebäude, wenn es in Nutzung ist, weiterhin genau beobachtet wird. Natürlich wird dieses ganze Verfahren Jahre dauern – und in unserem Kopf klingeln und klirren schon die imaginären Registrierkassen bei der Vorstellung, was uns das kosten wird.
Das Gebäude, das wir über das zweite Verfahren herstellen würden, könnte im Gegensatz dazu sehr schnell wieder freigegeben werden.
Klingt komisch? Ist aber genau so, wenn der EuGH die Rahmenbedingungen für die Zulassung von GVO regelt. Dazu ein kurzer Abriss, wie es dazu kommen konnte: Seit 1990 regelte eine europäische Freisetzungsrichtlinie, welche Organismen als GVO angesehen werden sowie welche Verfahren durchlaufen werden sollten, bevor GVO zur Freisetzung zugelassen werden können. Damit wollte man vor allem sicherstellen, dass transgene Pflanzen – also Pflanzen denen artfremdes Erbgut eingefügt wurde – vor ihrer Zulassung ausgiebig getestet werden.
Andere häufig angewendete Verfahren in der grünen Gentechnik sind Mutagenese-Verfahren, bei denen das Erbgut geschädigt wird – und zwar bis dato völlig ungerichtet. Meistens wird dazu entweder verdammt harte Strahlung verwendet – oder Chemikalien, von denen man weiß, dass sie Mutationen hervorrufen, und zwar nicht zu knapp. Die meisten dieser Schädigungen sind dabei weder für die Pflanze noch ihren Anbauer nützlich, aber manchmal gibt es eben Ausnahmen. Und da man das Ganze in Hochdurchsatzverfahren machen kann, kann man sich einfach jene Pflanzen heraussuchen, bei denen diese Schädigung irgendeinen Vorteil brachte.
Um die grüne Gentechnik, die bis Mitte der 1990er Jahre noch ein ziemlich positives Image hatte, voranzutreiben, waren derartige Pflanzen laut der EuGH-Richtlinie zwar als GVO einzustufen, aber dennoch von den besonders umfangreichen und strengen Regelungen auszunehmen, die für transgene Pflanzen anzuwenden sind. Diese Mutagenesis Exemption blieb dann auch unverändert bestehen, nachdem weite Teile der Bevölkerung die grüne Gentechnik ab Mitte der 1990er Jahre zu Schweinkram erklärten und sich infolgedessen die Zulassungsverfahren für transgene GVO mit der novellierten Freisetzungsrichtlinie von 2001 weiter verschärften.
Nun schreiben wir das Jahr 2020, und ich denke, es gibt kaum einen Leser, dem entgangen ist, dass wir seit einigen Jahren sehr spezifische beziehungsweise „programmierbare“ Nukleasen zur Verfügung haben. Die heißen so, weil sie zielgenau an einer vorher ausgesuchten Stelle im Genom einen Schnitt machen können. Einen Durchbruch sozusagen, sprichwörtlich! CRISPR und Kollegen sind also tatsächlich so etwas wie „Gen-Scheren“ und werden daher zurecht vom Volksmund auch gerne so genannt. Eben deswegen eignen sie sich vor allem hervorragend zur Mutagenese, und erst in einem technisch etwas aufwändigeren Prozess auch zur Transgenese.
Wer also in einem bestimmten Gen eine Mutation einbringen will, dem steht mit CRISPR und Co. heute das wohl zielgenaueste und präziseste Mutagenese-Werkzeug zur Verfügung, das es je gab.
2018 musste der EuGH entscheiden, ob Pflanzen, denen mittels dieser neuen Nukleasen Mutationen verpasst wurden, unter die Mutagenesis Exemption fallen oder nicht. Denn schließlich wurde diese Ausnahme zu einer Zeit formuliert, in der man nur die erwähnten Holzhammermethoden kannte.
Die europäische Pflanzenbiotechnologie erwartete dieses Urteil mit Spannung. Die Hoffnung in der Forschungsgemeinschaft war groß, dass man den Anschluss an das auch ökologisch so vielversprechende Feld der grünen Gentechnik nun vielleicht doch nicht völlig aus den Augen lassen musste. Das Urteil vom 25. Juli 2018 ließ sie jedoch mit heruntergeklappten Kinnladen zurück: Für Pflanzen, die mit Hilfe der modernen Werkzeuge präzise mutiert sind, gilt die Mutagenesis Exemption nicht, sondern eben nur für jene, die auf die gute alte Art brachial mit Strahlung oder Chemikalien behandelt wurden.
Wie hat der EuGH dieses merkwürdige Urteil begründet? Mit Verweis auf das Vorsorgeprinzip fand man, dass die neuen gentechnischen Werkzeuge noch nicht ausreichend erforscht seien. Das Vorsorgeprinzip ist zweifelsfrei ein wichtiger Baustein in der europäischen Gesetzgebung und ist dann anzuwenden, wenn „ein Phänomen, Produkt oder Verfahren potenzielle Gefahren birgt, die durch eine objektive wissenschaftliche Bewertung ermittelt wurden, und sich das Risiko nicht mit hinreichender Sicherheit bestimmen lässt.“
Wenn man sich in diesem Zusammenhang mit wissenschaftlich ermittelten Bewertungen zur Risikoabschätzung beschäftigt, dann ist es sehr wichtig zu unterscheiden, als welche Art von Werkzeug CRISPR eingesetzt wird. Es ging in dem Urteil nämlich nicht um CRISPR als Transgenese-Werkzeug – und damit sicher nicht um die Risikoabschätzung von zum Beispiel Gene Drives oder ähnlich elaborierten genetischen Konstruktionen, die man zurecht vorsorglich äußerst umfangreich testen sollte.
Worum aber dann?
Wenn es um reine Mutagenese geht, dann stößt man in der wissenschaftlichen Literatur hauptsächlich auf ein bestimmtes Problem, das beim Einsatz von CRISPR und anderen Nukleasen auftauchen kann: Off-Target-Effekte. Es ist tatsächlich momentan noch Gegenstand intensiver Forschung und nicht abschließend geklärt, wie oft und wie wahrscheinlich ein CRISPR-System auch an anderen Stellen im Genom einen Schnitt setzen könnte. Hoch ist die Rate von Off-Target-Effekten auf jeden Fall nicht, so viel steht schon mal fest. Aber auch eine geringe Rate könnte für den Einsatz von CRISPR in der Klinik von großer Bedeutung sein.
Für den Einsatz in der Pflanzenzucht jedoch ist eine Bezugnahme auf dieses Risiko in jedem Fall widersinnig. Schließlich muss sich hier CRISPR an herkömmlichen Verfahren messen lassen, die von vorneherein gar keine Targets haben – also im Prinzip ausschließlich Off-Target-Effekte hervorrufen, und zwar hunderte bis tausende. Und selbst diese Pflanzen, deren gesamtes Genom bombardiert wurde und von denen davon auszugehen ist, dass ihr Erbgut off target an vielen Stellen verändert wurde, haben sich in etlichen langanhaltenden Studien in keinerlei sicherheitsrelevanter Form als substantiell unterschiedlich zu konventionellen Nutzpflanzen herausgestellt.
Ich befinde mich derzeit in ziemlich guter Gesellschaft, wenn ich mich frage, warum bei der Risikobewertung von Nutzpflanzen überhaupt der Herstellungsprozess die entscheidende Rolle spielen sollte, und nicht eher ausschließlich das Produkt. Denn diese merkwürdige europäische Rechtslage führt dazu, dass theoretisch ein und dasselbe Produkt sehr verschieden strikte Zulassungsverfahren durchlaufen müsste, je nachdem mit welchem Verfahren es hergestellt wurde.
An dieser Stelle lade ich die Leserschaft erneut ein, sich noch mal unsere Situation mit den verschiedenen Häusern vorzustellen: Man könnte ja zurecht meinen, dass man, wenn man nur genug Kopien des Hauses nimmt, vielleicht auch ein Haus findet, das nach all dem Rütteln und Bombardieren zufällig noch relativ unversehrt geblieben ist – mit Ausnahme eben genau jener Säule, die wir entfernen wollten (zweifelsfrei feststellen können wir so etwas eher nicht). Nach der obigen Logik würde das nun zu der völlig verqueren Situation führen, dass wir zweimal das mutmaßlich identische Haus sehr unterschiedlich regulieren – je nachdem, ob die Säule rausgebombt oder rausgeschnitten wurde.
Analog lässt der EuGH theoretisch zwei komplett identische Produkte zwei sehr unterschiedliche Zulassungsverfahren durchlaufen, von denen eines so streng ist, dass es sich wirtschaftlich eigentlich nicht lohnt. Das Ganze wird nur noch absurder, wenn man sich vor Augen führt, dass es hinterher – nach der Erzeugung – niemandem mehr möglich ist, die beiden Saatgutsorten zu unterscheiden. Diese rechtliche Situation wurde in einem Editorial der Zeitschrift Nature Biotechnology 2018 die „Final Singularity of Nonsense“ genannt.
Tatsächlich hat sich auch in der experimentellen Pflanzenzucht und -forschung durch das Aufkommen von CRISPR und Co. ein Wandel von sogenannten Forward-Genetics-Ansätzen hin zu Reverse-Genetics-Ansätzen vollzogen. Unter Forward Genetics versteht man das ungerichtete Verändern des Erbgutes – über lange Zeit das einzige Vorgehen, das wir kannten. Welche Stellen des Genoms man mit seiner Manipulation getroffen hat, konnte man höchstens hinterher rausfinden, nachdem man sich die gewünschten Produkte einfach aufgrund ihrer Eigenschaften ausgewählt hat.
Heute, mit einem immer größer werdenden Erkenntnisschatz und Einblick in die Funktionen vieler Genomabschnitte, gehen wir oft den umgekehrten Weg. Die neuen Werkzeuge erlauben es uns, gezielt ein zu veränderndes Gen auszuwählen, dessen Mutagenese vielleicht schon bei anderen Pflanzen einen positiven Effekt hatte. Wenn sich ein solches Vorgehen beispielsweise auch in einer zweiten Pflanze als sehr nützlich herausstellt, dann kann man momentan das Produkt dieser Arbeiten in die Tonne kippen. Die Zulassungsvoraussetzungen für solch einen GVO zu erfüllen, für den die Mutagenesis Exemption nicht gilt, wäre in aller Regel viel zu aufwändig.
Wenn diese Pflanze aber wirklich vielversprechend ist, kann man natürlich noch eine andere Strategie verfolgen. Man nimmt die alten brachialen Mutagenese-Methoden und bombardiert die Pflanzen so lange mit Strahlung oder erbgutschädigenden Chemikalien, bis man durch Zufall ein Individuum erzeugt hat, in dem das gleiche Gen getroffen wurde. Vielleicht ist diese Pflanze nun wirklich fast identisch mit der zunächst im Forschungslabor präzise mittels CRISPR erzeugten. Dann wäre diese Vorgehensweise immerhin nur eine grandiose Vergeudung von Zeit, Geld und Ressourcen. Wer ein bisschen mehr kriminelle Energie mitbringt, könnte auch immer behaupten, die Pflanze sei althergebracht mutagenisiert worden, denn herausfinden lässt sich das durch die Analyse des Produktes nicht. Wahrscheinlicher ist aber, dass in dieser Pflanze nun auch noch andere Gene zu Schaden kamen, was vielleicht auch weniger erfreuliche Nebeneffekte haben könnte. Dem EuGH ist das jedoch egal, er ermöglicht die Zulassung dieser zweiten Pflanze in einem erheblich einfacheren Verfahren.
Zwei Jahre haben wir nun also schon diese befremdliche Rechtsprechung. Zwei Jahre, in denen sich unzählige Wissenschaftler innerhalb und außerhalb Europas – bisweilen auch im Namen ganzer Wissenschaftsorganisationen wie etwa die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina – konsterniert an die Öffentlichkeit gewandt haben. Es bleibt zu hoffen, dass die mittlerweile auch von Seiten des Europäischen Rates erfolgte Aufforderung an die Kommission, die europäische Position zu genomeditierten Pflanzen bis zum 30. April 2021 nochmals zu überdenken, Früchte trägt.
Bis dahin bleibt uns nur das Kopfschütteln, und vielleicht das Schreiben des einen oder anderen Essays.
Zur Autorin
Theresa Schredelseker ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Biologie 1 der Universität Freiburg sowie in der Klinik für allgemeine Kinder- und Jugendmedizin des dortigen Universitätsklinikums. Überdies betreibt sie den preisgekrönten Blog „Das Gen der Woche“.