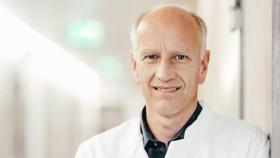Wie haben Sie sich als Forscher unterstützt gefühlt, als die Pandemie Deutschland erreichte?
Ulf Dittmer: Ich glaube, dass die Grundlagenforschung in Deutschland sehr gut funktioniert hat. Damit meine ich den Erkenntnisgewinn direkt über das Virus. Wir haben hier bei uns in Essen in rasender Geschwindigkeit die Genehmigung bekommen, mit SARS-CoV-2 im S3-Labor arbeiten zu dürfen. Das dauert eigentlich Monate, aber hier ging das wirklich innerhalb von Tagen. Solche Geschwindigkeiten bei der S3-Zulassung habe ich noch nie erlebt in meiner Karriere; Gentechnik-Behörden und Bezirksregierung haben sich da sehr flexibel gezeigt. Auch die Ethikkommissionen haben ein ungeheures Tempo vorgelegt, sodass wir Studien mit Patientenproben beginnen konnten. Ich glaube, das hat nicht nur hier in Essen gut geklappt, sondern in ganz Deutschland. Und sicher ist das einer der Gründe, warum wir in der Grundlagenforschung auch weltweit ganz vorn mit dabei sind.
Sie sprechen aber nur von Grundlagenforschung?
Dittmer: In der klinischen Forschung war das sicher nicht der Fall. Zum Beispiel klinische Studien zu Therapien – diese Daten kommen ja fast alle aus England, China oder den USA. Da muss man klar einräumen, dass wir in Deutschland einfach schlecht aufgestellt sind.
Aber ist es nicht auch ein Vorteil, wenn jedes Land seine eigenen Stärken hat? Solange jeder seine Ergebnisse zugänglich macht, profitieren doch alle davon.
Dittmer: Ich finde nicht, dass mit dieser Einstellung gute Forschung funktioniert. Wir können uns doch nicht damit abfinden, dass wir hier in Deutschland schlechte Strukturen für klinische Forschung haben und dann davon ausgehen, dass die Engländer schon für uns herausfinden, welche Therapieoptionen es zum Beispiel mit Remdesivir oder Chloroquin gibt oder eben nicht.
Was macht denn die Strukturen in Deutschland so schlecht, wenn es um klinische Forschung geht?
Dittmer: In Deutschland haben viele Unikliniken kein großes Interesse an gemeinsamen Studien. Denn das bedeutet ja auch, dass man mit dem eigenen Institut zurückstehen und dem Partner gewisse Daten überlassen muss. Als Erstes kommt der Konkurrenzgedanke auf. Das erschwert solche multizentrischen Studien hierzulande.
Mein Eindruck ist aber schon, dass deutsche Unikliniken gut eingebunden sind, sogar in weltweite Projekte, zum Beispiel zu den großen Volkskrankheiten. Ich denke etwa an die „Global-Burden-of-disease“-Studien, mit manchmal hunderten Autoren. Die kommen aus aller Welt, auch aus Deutschland. Also prinzipiell können klinische Institute hierzulande doch kooperieren.
Dittmer: Ja, da stimmt. Solche Projekte brauchen hier aber zwei bis drei Jahre Vorlauf. Wir sind in Essen ja auch an der Nationalen Kohorte beteiligt, deshalb habe ich das Prozedere ein bisschen mitbekommen. Es hat Jahre gebraucht, bis alle Verträge unterzeichnet waren und alle Ethikkommissionen sich abstimmen konnten. Diese Zeit hatten wir halt nicht in dieser Pandemie. In so einer Situation braucht man schnelle Antworten, wie man COVID-19-Patienten behandeln kann. Da können wir nicht erst auf Publikationen aus dem Ausland warten. Die Patienten haben ja hier gelegen, und einige sind leider auch gestorben.
Zum Vergleich: In Großbritannien ist das Gesundheitswesen staatlich organisiert. Über den National Health Service (NHS) hat jeder Brite automatisch Anspruch auf medizinische Versorgung. Die meisten Kliniken sind in dieses staatliche System eingebunden und auch enger mit Behörden zur Gesundheitsüberwachung verzahnt. Und offenbar können die Briten auch ihre Bevölkerung viel unbürokratischer in die Forschung einbinden, zum Beispiel über die REACT-Studien.
Dittmer: Ja, denn das System in England ist dadurch viel flexibler und kann schneller reagieren. Das staatlich organisierte System in England hat sicher auch viele Nachteile für das Gesundheitswesen, aber gerade klinische Multi-Center-Studien funktionieren dort sehr gut. Es gehören ja sowieso alle Krankenhäuser zusammen und tauschen daher auch Daten miteinander aus.
Aber neben den klinischen Daten sind da ja auch noch die Meldungen an die Gesundheitsämter samt Kontaktverfolgungen. Wir müssten doch im ersten Lockdown und dann über den Sommer genügend Daten haben, um zu beurteilen, wo sich die Menschen anstecken. Warum fehlen diese Daten?
Dittmer: Ich glaube, da hatten wir ein eklatantes Problem hier in Deutschland: Es ist uns nicht gelungen, Daten aus den Gesundheitsämtern, die eigentlich vorhanden waren, wissenschaftlich auszuwerten und in Handlungsanweisungen umzumünzen.
Aber der gesamte Sommer war doch ruhig, und es wäre jede Menge Zeit dafür gewesen!
Dittmer: Ich arbeite hier in Essen sehr eng mit dem Gesundheitsamt zusammen, und wir diskutieren hier auch viele Fälle. Ja, man hätte schon im Sommer viel mehr wissen können über Infektionsketten, denn diese Daten lagen den Gesundheitsämtern alle vor. Doch die Gesundheitsämter waren zu Beginn der Pandemie völlig überlastet. Zunächst gab es noch keine Möglichkeit, alle Daten elektronisch zu erfassen, deshalb musste man handschriftliche Notizen machen. Zum Teil spielten da auch Datenschutzfragen eine Rolle. Ich kenne viele Kollegen hier aus dem Gesundheitsamt in Essen, die im Frühling in ihrem Büro geschlafen haben!
Verständlicherweise mussten die Gesundheitsämter also im Sommer erstmal zwei Dinge tun: Ein bisschen durchatmen, und die handschriftliche Erfassung umstellen auf eine elektronische Datenerfassung. Da hatte man keine zusätzliche Zeit für andere Dinge. Hätte jedes Gesundheitsamt einen Wissenschaftler, der nichts anderes macht, als die vielen Daten zusammenzutragen und auszuwerten, dann wären wir deutlich weiter.
Also eigentlich forschen wir hierzulande sorgfältig an Grundlagen, aber wenn es schnell und unbürokratisch gehen muss, haben wir ein Problem. Trifft das auch auf die Forschungsförderung zu?
Dittmer: Es gab in der Pandemie eine Reihe von Fördermöglichkeiten und Forschungsgeldern von der DFG und vom BMBF. Es gibt dieses große Forschungsnetzwerk der Unikliniken, um COVID-19-Forschung zu unterstützen, und da sind 280 Millionen reingeflossen. Ich finde, auch das ist aber administrativ ziemlich komplex gestaltet. Unser System ist halt an der einen oder anderen Stelle zu träge für die Pandemie, und die Förderinstitutionen können ja jetzt auch nicht einfach von ihren eigenen Regeln abweichen. Da dauert vieles immer noch zu lang. Wir haben hier in Essen mit der Stiftung Universitätsmedizin darauf reagiert und über die Initiative „Spenden für Corona“ um Unterstützung gebeten. Innerhalb eines Monats kam eine Million Euro rein, und wir haben damit einen großen Teil unserer Forschung finanziert.
Mario Rembold
Bild: Stiftung Universitätsmedizin Essen/Mirko Raatz
Weitere „Corona-Gespräche“
- „Wir werden das Virus nicht auslöschen“
Der Charité-Virologe Christian Drosten erklärt, warum es derzeit nicht möglich ist, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 allein durch Massentestung unter Kontrolle zu kriegen – und beschreibt, welche Impferfolge wir stattdessen erwarten können.
- „Schade, dass es im Herbst nicht geklappt hat“
Viola Priesemann modelliert eigentlich, wie sich die neuronale Aktivität im Gehirn ausbreitet. Seit dem Frühjahr jedoch nutzt sie diese Expertise vor allem, um die Ausbreitung von SARS-CoV-2 in Populationen zu studieren. Im Interview ordnet sie die Corona-Maßnahmen ein und erklärt, worauf wir in Zukunft achten sollten.
- „Die Pandemie beeinträchtigt die psychische Gesundheit bestimmter Personengruppen“
Andreas Meyer-Lindenberg erforscht Risiko- und Resilienzmechanismen psychischer Erkrankungen. Im Interview erklärt er, welchen Einfluss Pandemie-bedingte Änderungen des Sozialverhaltens auf die menschliche Psyche haben.
Letzte Änderungen: 26.04.2021