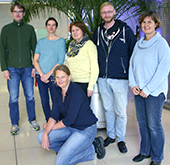Firmenportrait: Die Proteinjäger aus Berlin (Teil 1)
(17.11.16) Bei der Proteome Factory erfährt man, wie man komplexe Proteingemische analysiert: mit den allerneuesten, mit fast schon veralteten – und mit richtig alten Methoden.
Berlin, Südost. Im weitläufigen Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof sitzt eine der wenigen Firmen in Deutschland, die sich auf Dienstleistungen rund um die Proteomik spezialisiert hat. Auf rund hundert Quadratmeter Fläche nehmen sich acht Wissenschaftler derjenigen Frage an, aufgrund der sich schon so mancher Proteinbiologe in seine Pipette stürzen wollte: „Was ist in meiner Probe?“
Proteome Factory kann da oftmals helfen: Die Berliner Wissenschaftler offerieren Dienstleistungen und Produkte zur Proteinanalytik: etwa 2-D-Gelelektrophorese, verschiedenste Arten der massenspektrometrischen Analyse, und auch die Isolierung einzelner Proteinspots aus Gelmatrices – durchgeführt von „Spotxpress“, einem vollautomatischen Blechkameraden, der nur Strom, eine frische Mikrotiterplatte und einen fachkundigen Programmierer benötigt.
Metall in der Probe
Wie viele andere Biotech-Startups ist auch die Proteome Factory ein Kind ihrer Alma Mater, in diesem Fall: der TU Berlin. Im November 2000 gründeten der Biochemiker Christian Scheler, sein Doktorvater Johann Salnikow und einige weitere Kollegen von der TU und der Charité Berlin die Firma. Die Motivation dafür war platt: der schnöde Mammon.
Scheler hatte sich in seiner Doktorarbeit Ende der 1990er Jahre mit der Suche nach Biomarkern von Herz-/Kreislauf-Erkrankungen beschäftigt. Dafür hatte er das Proteom von Kardiozyten zweidimensional untersucht. Als Postdoc kam ihm die Idee, Proteine mit Lanthanoiden zu koppeln (wir erinnern uns aus dem Chemie-Praktikum: „Lanthanoide“, das sind Metalle der sogenannten „seltenen Erden“, die im Periodensystem die Ordnungszahlen 58 bis 71 haben).
Heute ist MeCAT (Metal-coded tagging) eine gängige Technologie, denn sie erlaubt nicht nur die relative, sondern auch die absolute Quantifizierung von Proteinen bis hinunter in den unteren Attomolarbereich: Die Lanthanoide werden über einen Chelatkomplex (DOTA) kovalent mit einem Protein gekoppelt. Ein Beispiel: Man möchte ein Protein X in einem Proteingemisch messen. Dazu generiert man einen Standard, für den man X mit Lutetium koppelt, während das Gemisch mit Terbium markiert wird (einfaches Vorgehen: Reagenzien zusammenkippen genügt). Dann wird eine definierte Menge Lutetium-markiertes X dem Gemisch beigegeben. Den Mix trennt man dann mit zweidimensionaler Gelelektrophorese, Polyacrylelektrophorese oder Flüssigchromatographie auf.
Unterschiedlich MeCAT-markierte Moleküle des gleichen Proteins co-migrieren. Somit isoliert man X als Mischung aus Lutetium- und Terbium-gekoppelten Molekülen.
Die absolute Quantifizierung bietet dann eine Analyse mittels ICP-MS (inductively coupled plasma mass spectrometry), einer robusten, sehr empfindlichen Methode. Da man nur wenige Metallionenspuren quantifiziert, ist die Datenauswertung sehr viel einfacher als zum Beispiel mit Isotopenmarkiertung. Auch de novo Sequenzierung ist möglich (dann via MALDI- oder ESI-MSMS), wie auch Multiplexing und Hochdurchsatz.
Ein Anker in Academia
2005 erhielt Scheler schließlich ein Patent auf die Technik. Doch fünf Jahre zuvor war sie lediglich eine junge Idee, an der er und seine Kollegen weiterforschen wollten. Dafür brauchten sie Geld. „Da hieß es: ‚2-D-Technik können wir, darauf bauen wir auf!’“, fasst Karola Lehmann, die jetzige Geschäftsführerin, den Gründungsgedanken zusammen. Scheler und seine Kollegen stellten in der Folge Anträge für Forschungsprojekte, für die sie 2-D-gelelektrophoretische Analysen machen konnten.
Über die Jahre arbeitete die Proteome Factory unter anderem mit der dermatologischen und der allergologischen Abteilung der Charité, dem Bundesinstitut für Bildung und Forschung (BMBF) und dem Leibniz-Institut für Gemüse- und Zierpflanzenbau zusammen. Doch bei der anfänglichen Finanzierung über Forschungsgelder blieb es nicht. Mit der Zeit nahm der Anteil an Dienstleistungsaufträgen immer mehr zu. Das habe „sich verselbstständigt“, erklärt Lehmann, man habe den einen Auftrag erledigt, und schon sei der nächste vor der Tür gestanden.
Die Auftraggeber waren zunächst vorwiegend kleinere Firmen, die nicht die Kapazitäten haben, die Analysen selbst durchzuführen. In den letzten Jahren seien jedoch vermehrt größere Pharmafirmen hinzu gekommen, da diese oftmals ihre eigene Forschung reduziert hätten. „Zu aufwändig“, gibt Lehmann die Begründung für diese Entwicklung. Der Trend gehe zum „Outsourcing“. Noch immer? Offenbar ja.
Dementsprechend sind die häufigsten Proben, die bei der Proteome Factory eingereicht werden, therapeutische Proteine und Antikörper. Doch auch pflanzliche Proben gehören zur Routine. Diese kämen meist von universitären Forschungsgruppen, „häufig mit Umweltaspekt“, fügt Lehmann an.
Kein Alleinstellungsmerkmal
Es dauerte, bis die junge Firma sich etabliert hatte. „Mindestens die ersten fünf Jahre“, schätzt Lehmann, „vielleicht sogar noch etwas länger.“ Das größte Hindernis war...
(Dieses Online-Firmenportrait ist ein Feature zur aktuellen Laborjournal-Ausgabe 11/2016 mit dem Titelthema "Protein-Protein-Interaktion". Am Freitag (18.11.) geht es hier auf LJ-online weiter mit dem zweiten Teil über die Proteome Factory - erfahren Sie dann, warum Forscher gerne eine Dienstleistung kaufen, die sie auch locker selbst erledigen könnten; warum die Nachbarschaft unter den Biotechfirmen im Wissenschaftspark Adlershof der Bundeshauptstadt so gut funktioniert; wieso im hippen Berlin neuerdings nicht nur das Stricken und Obst-Einwecken wieder total in ist, sondern auch die vermeintlich antiquierte Edman-Sequenzierung - und vieles mehr)
Text & Fotos: Julia Eckhoff