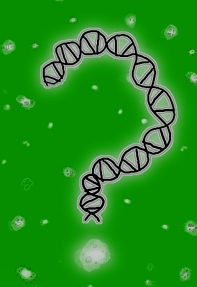Aus der Reihe „Spontane Interviews, die es nie gab — die aber genau so hätten stattfinden können”. Heute: Prof. E. Isern, Striktologisches Institut Universität Hochlattburg.
Aus der Reihe „Spontane Interviews, die es nie gab — die aber genau so hätten stattfinden können”. Heute: Prof. E. Isern, Striktologisches Institut Universität Hochlattburg.
LJ: Hallo Herr Isern, so tiefe Falten zwischen den Augenbrauen. Warum?
Isern: Ach, ich habe mich mal wieder über einen Kollegen geärgert, dessen Manuskript ich begutachten musste.
LJ: War es so schlecht?
Isern: Die weit verbreitete und scheinbar unausrottbare Schlamperei, dass die Zahl der Proben einfach zu klein war. Die Leute kapieren einfach nicht, dass man auf diese Art keine belastbare Statistik bekommen kann. Und dass die Ergebnisse auf diese Art nur Anekdoten bleiben, die keinerlei allgemein gültige Schlussfolgerungen erlauben. Diesen Beitrag weiterlesen »