Bescheidenheit ist eine Zier, hieß es früher einmal. In der Forschung jedoch scheint das immer weniger zu gelten. Da hat vielmehr die Unsitte des „Überverkaufens“ von Ergebnissen zuletzt immer stärker zugenommen.
Angesichts des stetig zunehmenden Publikations- und Karrieredrucks ist dies allerdings auch kein Wunder. Vom Ende seines Zeitvertrags oder Ähnlichem bedroht, bläst der eine oder die andere ein Fiat-Uno-Resultat im Paper-Manuskript gern zu einem Porsche auf. So manche Pressestelle verstärkt es umgehend nochmals – und in den sozialen Medien gerät es dann sowieso außer Kontrolle.
Dennoch ist solches „Überverkaufen“ von Forschungsergebnissen kein wirklich neues Phänomen. Wobei es bisher vielleicht noch eindrücklicher beim Beschreiben von Forschungsvorhaben auftrat. Denn zumindest beim Gerangel um Forschungsgelder wimmelt es schon seit Jahrzehnten in den Anträgen sinngemäß von deutlich übertriebenen Versprechungen wie: „Letztendlich könnten die Ergebnisse des Projekts in ein völlig neues Therapiekonzept für Krebs münden.“ Oder den Anbau und Ertrag aller möglichen Nutzpflanzen revolutionieren. Oder das Geheimnis lüften, wie in unseren Gehirnen Bewusstsein entsteht. Oder ähnliches überzogenes Antrags-Geklapper.
In diesem Zusammenhang hatte der Ökotoxikologe John Sumpter von der Londoner Brunel University zuletzt eine interessante Idee geäußert. In einem Essay in Times Higher Education schlägt er vor, in wissenschaftlichen Artikeln den Abschnitt „Conclusions“ durch „Limitations“ zu ersetzen. In den „Conclusions“ würde ohnehin nur wiederholt, was schon weiter vorne steht, so Sumpter. Müssten die Autoren dagegen gezielt formulieren, wo die Grenzen für die Interpretation ihrer Ergebnisse liegen, erhielte man am Ende womöglich deutlich robustere Paper.
Auf jeden Fall hätten auf diese Weise wohl arg überzogene Schlussfolgerungen wie die folgende ein Ende: „Weitere Forschung in dieser Richtung könnte es nun ermöglichen, die Ausprägung des Darm-Mikrobioms durch gezielte Interventionen so zu steuern, dass die kognitive Entwicklung von Kleinkindern unterstützt wird.“ (Biol. Psychiat. 83(2), 148-59) Argh! Nicht zu Unrecht zeichnete der US-Mikrobiologe Jonathan Eisen dieses Paper in seinem Blog Phylogenomics mit dem „Overselling the Microbiome Award“ aus.
Ralf Neumann
(Illustr.: R@TTENcomiCS)


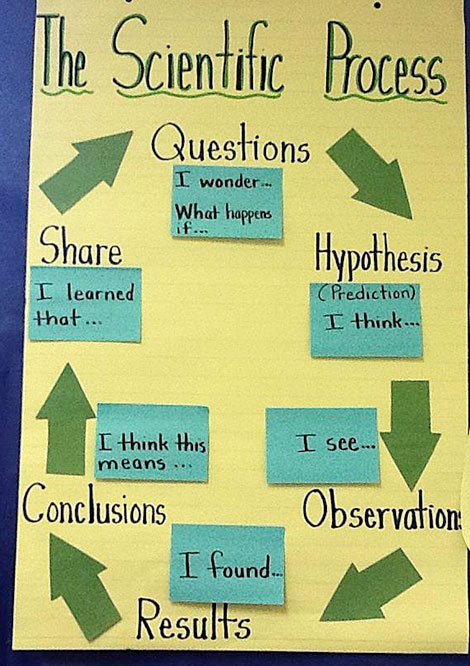
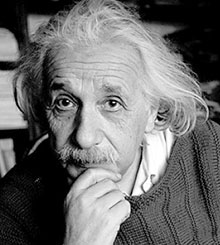 Auch Einstein hielt anfangs nicht viel von Peer Review. Aus seiner „deutschen Zeit“ kannte er dieses System, etwa von seinen fünf berühmten 1905er-Artikeln in den Annalen der Physik, überhaupt nicht. Erst nachdem er in die USA ausgewandert war, sah er sich plötzlich damit konfrontiert, dass seine Manuskripte bisweilen zunächst irgendwelchen Kollegen zur Begutachtung vorgelegt wurden.
Auch Einstein hielt anfangs nicht viel von Peer Review. Aus seiner „deutschen Zeit“ kannte er dieses System, etwa von seinen fünf berühmten 1905er-Artikeln in den Annalen der Physik, überhaupt nicht. Erst nachdem er in die USA ausgewandert war, sah er sich plötzlich damit konfrontiert, dass seine Manuskripte bisweilen zunächst irgendwelchen Kollegen zur Begutachtung vorgelegt wurden.



