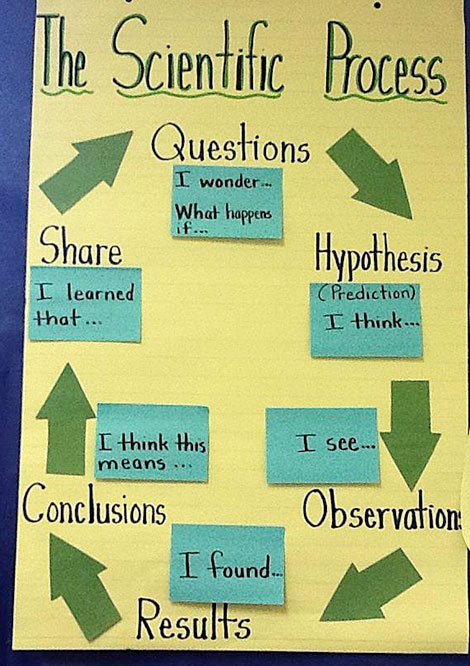„Okay, erstmal kurz nachdenken! Wie pack ich’s jetzt an? Wie schreibe ich all das nette Zeug jetzt auf?
„Okay, erstmal kurz nachdenken! Wie pack ich’s jetzt an? Wie schreibe ich all das nette Zeug jetzt auf?
Dass ich das alles nicht so bringen kann, wie es sich wirklich abgespielt hat, ist klar. Die ganzen Irrungen und Wirrungen, die Umwege, Rückbesinnungen und Neustarts, bis wir endlich am Ziel waren — da wird der Leser ja wahnsinnig.
Warum also die Einzelteile nicht neu ordnen und das Ganze wie einen Thriller aufziehen? Zuerst beschreibe ich die Reise unseres kleinen Trupps zum Ort des Geschehens (und illustriere sie in Fig. 1), um dann dort eingehend die Umgebung zu erkunden (Fig. 2). Dabei stoßen wir natürlich — Trommelwirbel! — zielsicher auf ein ziemlich unerwartetes und dunkles Mysterium (Fig. 3).
Mit allen Mitteln der Kunst untersuchen wir den rätselhaften Ort — und sammeln tatsächlich einen Hinweis nach dem anderen, was hier eigentlich vor sich gehen könnte (Fig. 4 A bis H). Bis wir an den Punkt kommen, an dem wir innehalten und versuchen, all diese Hinweise zu einem sinnvollen Muster zu ordnen (Fig. 5 A bis D). Und dabei fällt es uns plötzlich wie Schuppen von den Augen, so dass wir — nochmal Tata! — die logische Antwort auf unser Mysterium schließlich glasklar vor uns liegen sehen (Fig. 6).
Zum endgültigen Abrunden der Story bleibt dann nur noch der Epilog, der das finale Fazit noch mal schön klar zusammenfasst (Fig. 7). Et violá!“
(… Kurzes Innehalten, dann weiter…)
„Hm… Klingt zwar gut, keine Frage. Allerdings… Ich befürchte, dass wohl nur die Allerwenigsten mein ausgefeiltes Präsentationskonzept inklusive perfekt arrangiertem Spannungsaufbau überhaupt registrieren werden. Denn wie mache ich es denn selbst als Leser? Bei der wenigen Zeit, die man für die Literatur hat? Eigentlich läuft es doch immer etwa so:
Ich schaue mir jedes Paper gerade mal bis zur Fig. 1 an, höchstens bis zur Fig. 2. Da muss es mich schon ganz schön packen, dass ich mir mehr anschaue… Was eigentlich nie passiert, da die Auflösung ja sowieso schon vorne im Abstract steht. Also schaue ich mir lieber schnell das nächste Paper an… und das nächste… und das nächste….
Vielleicht sollte ich es also doch lieber andersherum aufziehen und den großen Clou der Story gleich vorne in die Fig. 1 stecken. Dann würden all die potenziellen „Schnellgang-Drüberschauer“ vielleicht wenigstens die Hauptbotschaft mitnehmen. Und wer aus irgendeinem Grund dennoch weiter liest, bekommt dann eben noch die ganzen Hintergründe dazu…
Hm… Ich glaube, so mach‘ ich’s! Man muss am Ende eben doch nach dem gehen, wie die Leute ticken, die man erreichen will.“
Ralf Neumann
x