 Mitarbeiter der Annals of Internal Medicine stellten vorletzte Woche auf dem International Congress for Peer Review and Scientific Publication die Ergebnisse einer ziemlich interessanten Befragung vor. Deren Thema: Missbrauch von eingereichten Manuskripten durch Peer Reviewer (Originaltitel: Misuse of Received Manuscripts by Peer Reviewers: A Cross-sectional Survey).
Mitarbeiter der Annals of Internal Medicine stellten vorletzte Woche auf dem International Congress for Peer Review and Scientific Publication die Ergebnisse einer ziemlich interessanten Befragung vor. Deren Thema: Missbrauch von eingereichten Manuskripten durch Peer Reviewer (Originaltitel: Misuse of Received Manuscripts by Peer Reviewers: A Cross-sectional Survey).
Als Resultat halten sie zunächst einmal fest:
A total of 1431 of 3275 invited reviewers (44%) returned the survey […] Nearly half indicated having reviewed and published more than 50 manuscripts and having mentored others in peer review. Reasons reported for agreeing to review included keeping up to date in a research field (957/1417 [68%]), a sense of obligation to peer review (1316/1417 [93%]), …
So weit, so gut. Mit dem nächsten Grund, warum die Befragten die Manuskripte zur Begutachtung annehmen, wird es dann allerdings schon etwas kniffliger:
… and to know what competitors are doing (190/1417 [13%]).
Aha — ganze 13 Prozent der Befragten gaben also zu, Manuskripte vor allem deswegen zur Begutachtung anzunehmen, weil es ein guter Weg sei, sich darüber zu informieren, was die Konkurrenz so treibt. Da man derlei aber selbst in anonymen Umfragen aus selbstwertdienlichen Gründen nicht wirklich gerne preisgibt, dürften die 13 Prozent die tatsächliche Realität sogar noch schmeichelhaft abbilden.
Doch es kommt noch besser:
One hundred sixty-nine of 1417 (12%) had agreed to review manuscripts from authors with whom they had conflicts of interest; of these, 61 (36%) did so without informing the journal’s editor. One hundred fifty-three of 1413 (11%) showed manuscripts to colleagues without seeking permission.
Diese Art „Schindluder-Verhalten“ gibt man in diesem Zusammenhang sicher noch weniger gerne zu. Mit der Folge, dass die „Dunkelziffern“ für diese Art Missbrauch von anvertrauten Manuskripten nochmals höher ausfallen dürften.
Gleiches gilt natürlich auch für das letzte vorgestellte Ergebnis der Befragung:
Twenty-six of 1414 (2%; 95% CI, 1%-3%) indicated having used the information in a reviewed manuscript for personal or academic benefit prior to the paper’s publication. Such reported use included using what was learned to alter one’s own research plans, speeding up journal submission of one’s own work related to the subject of the manuscript being reviewed, and copying some part of the reviewed manuscript for one’s own work.
Okay, das sind zwar nur zwei Prozent — aber dennoch heißt das zusammen mit den anderen, bereits genannten Ergebnissen schlichtweg, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Autoren und Gutachtern, auf dem das gesamte Peer-Review-System fußt, offenbar deutlich öfter gebrochen wird, als einem lieb sein kann.
Entsprechend schreiben die Autoren dann auch in ihrer Conclusion:
Trust that reviewers will treat manuscripts received for peer review as confidential communications is an essential tenet of peer review. Although self reported and of uncertain generalizability, these results suggest that breaches of this trust do occur. Larger studies involving multiple journals should be considered to assess the generalizability of these results and to inform targeted educational initiatives aimed at promoting the highest ethical standards among peer reviewers.
Kommentare, Meinungen oder gar eigene Erlebnisse zu potenziellem Peer-Review-Missbrauch nehmen wir gerne entgegen. Entweder direkt hier über das unten folgende Kommentarfenster, oder auch diskreter via Mail an die Laborjournal-Redaktion.
 Jetzt stand sein erstes Treffen mit dem gesamten Board an, bei dem wie in jedem Jahr die Editorial Policy kritisch geprüft sowie die Schwerpunkte neu fokussiert wurden. Unser junger Mann war beeindruckt von der Routine, mit der die erfahrenen Forscher und langjährigen Editoren die Dinge auf den Punkt brachten. Alles war so, wie er es sich vorgestellt hatte.
Jetzt stand sein erstes Treffen mit dem gesamten Board an, bei dem wie in jedem Jahr die Editorial Policy kritisch geprüft sowie die Schwerpunkte neu fokussiert wurden. Unser junger Mann war beeindruckt von der Routine, mit der die erfahrenen Forscher und langjährigen Editoren die Dinge auf den Punkt brachten. Alles war so, wie er es sich vorgestellt hatte.
 Denn sie wissen nicht, was sie tun. — Viele dürfte diese Zeile unmittelbar an den gleichnamigen Filmklassiker mit James Dean erinnern. Heute könnte sie jedoch auch für einen großen Teil biomedizinischer Forschung gelten.
Denn sie wissen nicht, was sie tun. — Viele dürfte diese Zeile unmittelbar an den gleichnamigen Filmklassiker mit James Dean erinnern. Heute könnte sie jedoch auch für einen großen Teil biomedizinischer Forschung gelten. Mitarbeiter der Annals of Internal Medicine stellten vorletzte Woche auf dem
Mitarbeiter der Annals of Internal Medicine stellten vorletzte Woche auf dem 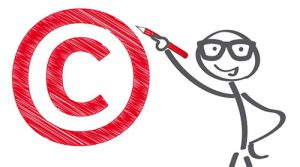

 Worin unterscheidet sich die Wissenschaft von Pfannen? Zugegeben, der Kalauer mag an den Haaren herbeigezogen sein — aber sei‘s drum: Pfannen reinigen sich immer besser selbst, in der Wissenschaft dagegen…
Worin unterscheidet sich die Wissenschaft von Pfannen? Zugegeben, der Kalauer mag an den Haaren herbeigezogen sein — aber sei‘s drum: Pfannen reinigen sich immer besser selbst, in der Wissenschaft dagegen… Die Institutionen sollen ihren Teil zu Reproduzierbarkeit und zuverlässige Forschung beitragen — das fordern Ulrich Dirnagl, Leiter des Schlaganfallcentrums an der Charité Berlin, sowie Glenn Begley, leitender Wissenschaftler bei der US-Firma TetraLogic Pharmaceuticals, und Alastair Buchan, Medizindekan an der Universität Oxford ganz frisch in Nature (
Die Institutionen sollen ihren Teil zu Reproduzierbarkeit und zuverlässige Forschung beitragen — das fordern Ulrich Dirnagl, Leiter des Schlaganfallcentrums an der Charité Berlin, sowie Glenn Begley, leitender Wissenschaftler bei der US-Firma TetraLogic Pharmaceuticals, und Alastair Buchan, Medizindekan an der Universität Oxford ganz frisch in Nature ( Über eine Reform des Peer Review-Systems lässt sich trefflich streiten. Ein immer wieder ins Feld geführtes Argument gegen den klassischen Peer Review ist jedoch nicht ganz fair: Dass die Zunahme getürkter Paper in der Forschungsliteratur doch zeige, wie unzulänglich die Begutachtung funktioniert. Beispielsweise in diesem
Über eine Reform des Peer Review-Systems lässt sich trefflich streiten. Ein immer wieder ins Feld geführtes Argument gegen den klassischen Peer Review ist jedoch nicht ganz fair: Dass die Zunahme getürkter Paper in der Forschungsliteratur doch zeige, wie unzulänglich die Begutachtung funktioniert. Beispielsweise in diesem  Als er sich schließlich halbwegs von dem Schock erholt hatte, stieg Zorn in ihm hoch — und er begann, sich „das Arschloch“ vorzustellen. „Sicher so ein frustrierter alter Sack, kurz vor der Pensionierung“, dachte X. „Ein ergrautes, faltiges Alphatier, das Spaß daran hat, den Jungen nochmal so richtig zu zeigen, wo der Hammer hängt. Der ansonsten aber gerade darüber verbittert, dass seine Zeit nun endgültig bald vorbei ist. Da kommt ihm ein Manuskript von so einem kleinen Würstchen wie mir natürlich gerade recht, um all den Frust und die Verbitterung unerkannt, aber wirksam rauszulassen.“
Als er sich schließlich halbwegs von dem Schock erholt hatte, stieg Zorn in ihm hoch — und er begann, sich „das Arschloch“ vorzustellen. „Sicher so ein frustrierter alter Sack, kurz vor der Pensionierung“, dachte X. „Ein ergrautes, faltiges Alphatier, das Spaß daran hat, den Jungen nochmal so richtig zu zeigen, wo der Hammer hängt. Der ansonsten aber gerade darüber verbittert, dass seine Zeit nun endgültig bald vorbei ist. Da kommt ihm ein Manuskript von so einem kleinen Würstchen wie mir natürlich gerade recht, um all den Frust und die Verbitterung unerkannt, aber wirksam rauszulassen.“



