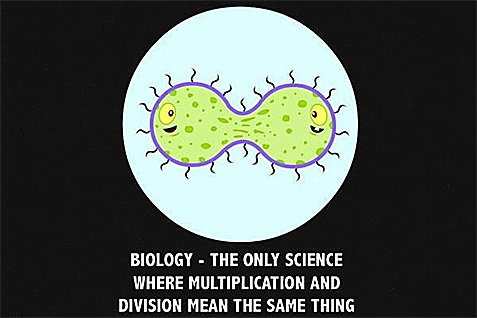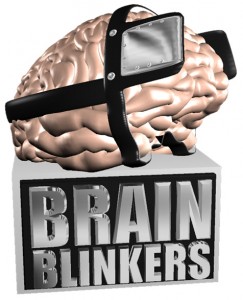(Vor knapp vier Jahren erschien der folgende Text in unserer Print-Kolumne „Inkubiert“. Wir finden, er hat eine neuerliche Diskussion verdient.)
Zu den zentralen Aufgaben wissenschaftlichen Arbeitens gehört es, Modelle und Theorien zu entwickeln. So sollte man jedenfalls meinen.

Die Realität jedoch sieht anders aus. Seitdem Forschung zunehmend projektorientiert stattfindet und sich über Publikationsmetriken definiert, scheint „Theoriearbeit“ nicht mehr angesagt. Vor einiger Zeit bilanzierte etwa eine Studie zu exakt diesem Thema, dass von 500 untersuchten Forschungsprojekten nur etwa zehn Prozent „genuine Theoriearbeit“ beinhalteten. Der gewaltige Rest beschränkte sich laut den Autoren größtenteils auf die punktuelle Analyse eines konkreten Falles und verzichtete schon im Ansatz auf jegliche Form der Generalisierung.
Welche Art Forschung auf diese Art herauskommt, ist klar: Überschaubare Projekte, die fest auf bekannten Theorien fußen und daraus abgeleitete Fragen mit bekannten Methoden bearbeiten — Forschung mit eingebauter Ergebnisgarantie, bei gleichsam dürftigem Erkenntnispotenzial.
Aber sollte Forschung nicht eigentlich Türen ins Unbekannte aufstoßen? Augenscheinlich muss man es sich wirklich wieder neu in Erinnerung rufen. Denn offenbar scheint der Löwenanteil aktueller Forschungsprojekte nicht wirklich daraufhin angelegt. Was natürlich auch dadurch unterstützt wird, dass das Klima gerade generell von einer Theorie-feindlichen Großwetterlage geprägt wird. Denn was passiert beispielsweise, wenn sich doch mal jemand traut, in einem Manuskript über den Tellerrand zu blicken und aus den vorgestellten Daten ein generalisierendes Modell entwickelt? Die Chance ist groß, mit der Totschlag-Floskel „zu spekulativ“ wieder zurück auf Start geschickt zu werden.
Doch warum ist „spekulativ“ heutzutage derart negativ besetzt? Natürlich sind Modelle und Theorien spekulativ — was denn sonst? Es wird ja auch kaum einer von Vorneherein behaupten, sein Modell sei korrekt. Weil Modelle und Theorien allenfalls nützlich sein können, das Unbekannte weiter zu entschlüsseln. Ganz in dem Sinne, wie Sydney Brenner es vor einiger Zeit formulierte:
„Die Hauptsache ist, sich mit Möglichkeiten befassen zu können. Dinge einfach auszusprechen, auch wenn sie falsch sein mögen. Indem ich sie ausspreche, kann ich besser erkennen, was daran falsch sein könnte. Und das kann wiederum zu einer robusteren Idee führen. Letztlich geht es also darum, die Dinge nicht zurückzuhalten.“
Oder vorschnell als „zu spekulativ“ abzuqualifizieren.

 Wenn man Forscher fragt, was zu den schlimmsten Dingen gehört, die ihnen widerfahren können, gehört eines sicherlich zum engeren Kreis: Etwas publizieren, was sich später als falsch herausstellt.
Wenn man Forscher fragt, was zu den schlimmsten Dingen gehört, die ihnen widerfahren können, gehört eines sicherlich zum engeren Kreis: Etwas publizieren, was sich später als falsch herausstellt.