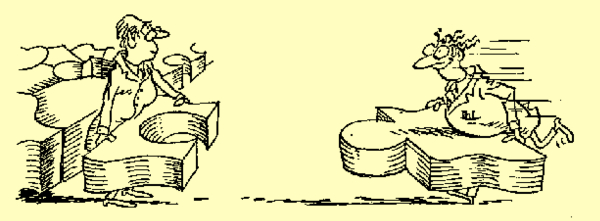
Die Klagen aus der Grundlagenforschung nahmen zuletzt hörbar zu: „Apply or die!“ – „Wende an oder stirb!“ –, schon länger lautet so deren sarkastischer Kommentar auf den wachsenden Druck, dass die Wissenschaft möglichst Ergebnisse produzieren solle, die unmittelbar in konkrete Anwendungen münden können. Klar, das ist kein schlechtes Ziel. Dennoch mahnen insbesondere die Vertreter der akademischen Grundlagenforschung an, dass mit zu starker Priorisierung des Anwendungsaspekts ihre Forschungsfreiheit zunehmend ausgehöhlt werden könnte. Und die ist immerhin verfassungsrechtlich garantiert.
Hintergrund ist natürlich, dass die Forschungspolitik immer vehementer ein klar ersichtliches Anwendungspotenzial in den Projekten der Forscher fordert – und dass die Forschungsförderer daher immer größere Schwierigkeiten haben, reine und ergebnisoffene Grundlagenforschung zu finanzieren. Dabei ist doch allseits bekannt, dass die allermeisten Dinge, die heute „in Anwendung“ sind, ihren Ursprung in völlig zweckfreien, von reiner Neugier getriebenen Forschungsunternehmungen hatten: Antibiotika, Röntgenbilder, Genetischer Fingerabdruck, … – nur drei Beispiele von vielen.
Bei allen diesen Errungenschaften dämmerte das Anwendungspotenzial erst, nachdem man die zugrundeliegenden Phänomene auch wirklich grundlegend verstanden hatte. Und in den meisten Fällen hatte man nicht mal mit zielgerichteten Forschungsplänen nach ihnen gesucht. Vielmehr stieß man im freien Schalten und Walten ergebnisoffener Grundlagenforschung eher zufällig auf ein bislang unbekanntes Phänomen, erkannte die Bedeutung der Resultate – und analysierte das Phänomen durch gezieltes Experimentieren weiter, bis man es grundlegend verstand. Erst dann kamen die Ideen, wie und wofür man das Ganze konkret weiterentwickeln und anwenden konnte.
So weit, so gut. Jetzt lesen wir mal vor diesem Hintergrund die folgenden Zeilen aus einer Pressemeldung der Ruhr-Universität Bochum:
Alte Gelbe Enzyme, kurz OYEs, vom englischen Old Yellow Enzymes, wurden in den 1930er-Jahren entdeckt und seitdem stark erforscht. Denn diese Biokatalysatoren – gelb gefärbt durch ein Hilfsmolekül – können Reaktionen durchführen, welche für die chemische Industrie sehr wertvoll sind, etwa Medikamentenvorstufen oder Duftststoffe herstellen. Obwohl OYEs in vielen Organismen vorkommen, ist ihre natürliche Rolle für diese Lebewesen bisher kaum bekannt – möglicherweise, weil der wissenschaftliche Fokus auf der biotechnologischen Anwendung lag.
Und springen von hier in das Abstract des in der Pressemitteilung vorgestellten Papers eines Teams von Bochumer Chlamydomonas-Forscherinnen und -Forscher (Plant Direct, doi: 10.1002/pld3.480). Auch hier lauten gleich die ersten zwei Sätze: Diesen Beitrag weiterlesen »


 Und wieder ein Zitat aus einer E-Mail an unsere Redaktion. Ein Bio-Emeritus im aktiven Unruhestand prangert darin mit deutlichen Worten einige „Unsitten“ im aktuellen Forschungsbetrieb an:
Und wieder ein Zitat aus einer E-Mail an unsere Redaktion. Ein Bio-Emeritus im aktiven Unruhestand prangert darin mit deutlichen Worten einige „Unsitten“ im aktuellen Forschungsbetrieb an: Es soll ja vorkommen, dass hin und wieder ein eingefleischter Biochemiker im Vortrag eines dezidierten Genetikers sitzt. Oft genug sitzt er dann da, hört zu, denkt mit — und wartet vergeblich auf den Clou.
Es soll ja vorkommen, dass hin und wieder ein eingefleischter Biochemiker im Vortrag eines dezidierten Genetikers sitzt. Oft genug sitzt er dann da, hört zu, denkt mit — und wartet vergeblich auf den Clou. Was machbar ist, wird in der Regel auch gemacht. Vor allem wenn einem als Forscher, der ja immer etwas am Laufen haben muss, gerade nichts Originelles einfallen will, ist die Verlockung besonders stark. Nur allzu gerne folgt er dann diesem Imperativ der reinen Machbarkeit. Es hat ja auch Vorteile: Man braucht kaum komplizierte Konzepte, ein oftmals recht plakativer Zweck reicht meist schon aus. Und man kann es leicht verkaufen. Denn was machbar ist, bietet eine gewisse Ergebnisgarantie. Wenn ich ein Genom sequenziere, habe ich am Ende eine Sequenz — und das ist doch schon mal was. Welche Erkenntnisse mir die Sequenz bringt — nun, das kann man dann noch sehen. Sehr beliebt unter diesen konzeptionsarmen „Just do it, think later“-Ansätzen sind auch sogenannte „Fishing Expeditions“. Etwa einfach mal ein Genexpressionsmuster aufnehmen — geht ja leicht heutzutage –, Konzepte entwickeln sich dann (hoffentlich) mit den Daten. Oder auch nicht. Vor kurzem wurde dieses Thema in einem Weblog im Zusammenhang mit der Schlafforschung diskutiert. Ein wenig erfolgreiches Feld, wie die Teilnehmer meinten. Immer noch weiß man nicht, was Schlaf eigentlich ist und warum er sich evolutionsgeschichtlich entwickelt hat. Und weil einem vor lauter Konzeptionsleere nichts mehr einfiel, begann man „nach Schlafgenen zu fischen“. Die lächerliche Beute? Die üblichen allgegenwärtigen Verdächtigen in Hirnzellen: Proteinkinasen, Dopaminrezeptoren, Serotonintransporter, und so weiter. Einer der Blogger fuhr daraufhin aus der Haut: „Verstehen die nicht, dass Schlaf eine emergente Eigenschaft des multizellulären Gehirns ist? Nicht einzelne Neuronen schlafen (oder sind wach) — die Gehirne tun das. Der „Schlafmechanismus“ ist kein molekularer Mechanismus, sondern das Ergebnis eines speziellen Musters neuronaler Aktivität und Konnektivität.“ Gutes Beispiel, dass ein wenig konzeptionelles Denken sich durchaus lohnen kann, bevor man einfach macht, was eben geht.
Was machbar ist, wird in der Regel auch gemacht. Vor allem wenn einem als Forscher, der ja immer etwas am Laufen haben muss, gerade nichts Originelles einfallen will, ist die Verlockung besonders stark. Nur allzu gerne folgt er dann diesem Imperativ der reinen Machbarkeit. Es hat ja auch Vorteile: Man braucht kaum komplizierte Konzepte, ein oftmals recht plakativer Zweck reicht meist schon aus. Und man kann es leicht verkaufen. Denn was machbar ist, bietet eine gewisse Ergebnisgarantie. Wenn ich ein Genom sequenziere, habe ich am Ende eine Sequenz — und das ist doch schon mal was. Welche Erkenntnisse mir die Sequenz bringt — nun, das kann man dann noch sehen. Sehr beliebt unter diesen konzeptionsarmen „Just do it, think later“-Ansätzen sind auch sogenannte „Fishing Expeditions“. Etwa einfach mal ein Genexpressionsmuster aufnehmen — geht ja leicht heutzutage –, Konzepte entwickeln sich dann (hoffentlich) mit den Daten. Oder auch nicht. Vor kurzem wurde dieses Thema in einem Weblog im Zusammenhang mit der Schlafforschung diskutiert. Ein wenig erfolgreiches Feld, wie die Teilnehmer meinten. Immer noch weiß man nicht, was Schlaf eigentlich ist und warum er sich evolutionsgeschichtlich entwickelt hat. Und weil einem vor lauter Konzeptionsleere nichts mehr einfiel, begann man „nach Schlafgenen zu fischen“. Die lächerliche Beute? Die üblichen allgegenwärtigen Verdächtigen in Hirnzellen: Proteinkinasen, Dopaminrezeptoren, Serotonintransporter, und so weiter. Einer der Blogger fuhr daraufhin aus der Haut: „Verstehen die nicht, dass Schlaf eine emergente Eigenschaft des multizellulären Gehirns ist? Nicht einzelne Neuronen schlafen (oder sind wach) — die Gehirne tun das. Der „Schlafmechanismus“ ist kein molekularer Mechanismus, sondern das Ergebnis eines speziellen Musters neuronaler Aktivität und Konnektivität.“ Gutes Beispiel, dass ein wenig konzeptionelles Denken sich durchaus lohnen kann, bevor man einfach macht, was eben geht.



