In unserem aktuellen Sommer-Essayheft preist Ulrike Kaltenhauser, Geschäftsführerin mehrerer bayrischer Forschungsnetzwerke, die Vorzüge von… – ja klar, Forschungsnetzwerken.
 So schreibt sie etwa:
So schreibt sie etwa:
Im Freistaat Bayern setzt man schon seit vielen Jahren gezielt auf die Erfahrung, dass sich das Bündeln der wissenschaftlichen Kapazitäten in Form von Netzwerken in jedem Fall auszahlt. […] Schnell stellte sich heraus, dass solche Netzwerkprojekte effizienter und mit einer deutlich höheren Ausbeute die angestrebten Ziele erreichen und sogar darüber hinaus Mehrwert erzeugen. Inzwischen sind die Forschungsverbünde aus der bayerischen Forschungslandschaft nicht mehr wegzudenken.
Oder an anderer Stelle:
Verbundforschung bildet eine der besten Grundlagen für Innovationen und Wertschöpfung und damit auch für wissenschaftlichen Erfolg.
Erst ganz am Ende mischen sich auch andere Töne in die Euphorie:
[…] Dennoch traue ich mir nicht wirklich zu, die Frage zu beantworten, ob Netzwerke tatsächlich das Leben vereinfachen, da gerade die Zusammenarbeit von ambitionierten Menschen nie einfach ist. Nichtsdestotrotz bin ich mir sicher, dass die Kooperation mit anderen Projektpartnern für alle Beteiligten einen Gewinn darstellt und sich in den meisten Fällen positiv auf die Karriere der einzelnen Akteure auswirkt. Die aktive Zusammenarbeit mit regen Geistern beflügelt den wissenschaftlichen Fortschritt. Es ist nicht immer einfach, aber in den meisten Fällen ein echter Mehrwert, Teil eines lebendigen Netzwerks zu sein.
So bekommt man am Ende doch eine klitzekleine Ahnung davon, dass Netzwerke, Konsortien und Verbünde oftmals auch kritischer gesehen werden — insbesondere vonseiten der Wissenschaftler. Deren Hauptvorwurf: Allzu leicht würden durch das „Einpferchen“ in Netzwerke und Verbünde Zwänge erzeugt, die das unabhängige Denken und die Kreativität der einzelnen Akteure letztlich eher einschränken.
Ein schönes Beispiel dafür lieferte vor einigen Jahren die Episode „Caught in the Net“ der Observations of The Owl in unserer englischsprachigen Schwesterzeitschrift Lab Times. Hier kostete der „Zwang zum Netzwerken“ einen Wissenschaftler förmlich die Karriere — wie The Owl am Ende (auf englisch) folgendermaßen beschrieb:
My friend was an excellent researcher. He wasn‘t even a true, teamwork-phobic loner. However, he was one of those scientists who function most brilliantly when allowed to think and work completely on their own. He certainly wasn’t a networker. So it was sad to see how his research began to splutter from that “network episode” on. He finally ended up at a small technical college.
So much for the synergy that research networks create.
Zwei diametral entgegengesetzte Positionen also: Forschungsnetzwerke wirken sich positiv auf die Karrieren der einzelnen Akteure aus — oder eben gerade nicht.
Was stimmt jetzt? Und für wen? Oder vielleicht differenzierter: Wann wirken sie sich positiv aus — und wann nicht?
Viel Stoff zum Kommentieren und Diskutieren. Wer fängt an?
Ralf Neumann
(Illustr.: „Flying Lesson“ von Robert und Shana ParkeHarrison)
x
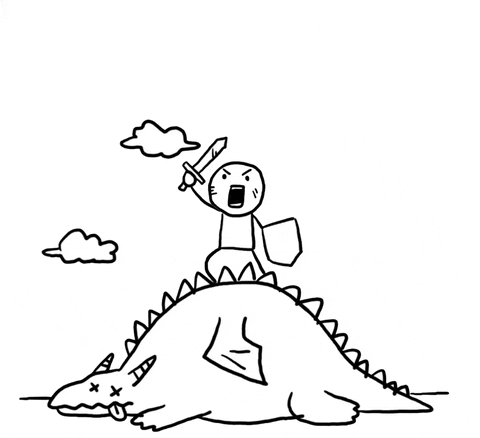

 So schreibt sie etwa:
So schreibt sie etwa: Die Forschung hat Gesichter bekommen. Erfreulicherweise. Seit einiger Zeit schon nehmen Zeitschriften regelmäßig „eine Forschernase“ in den Mittelpunkt einer ganzen Seite — ob in Interviews oder Artikel — und zeigen diese auch in großen Fotos oder Zeichnungen. Und das nicht nur, wenn’s Nobelpreise gegeben hat, sondern regelmäßig.
Die Forschung hat Gesichter bekommen. Erfreulicherweise. Seit einiger Zeit schon nehmen Zeitschriften regelmäßig „eine Forschernase“ in den Mittelpunkt einer ganzen Seite — ob in Interviews oder Artikel — und zeigen diese auch in großen Fotos oder Zeichnungen. Und das nicht nur, wenn’s Nobelpreise gegeben hat, sondern regelmäßig.




