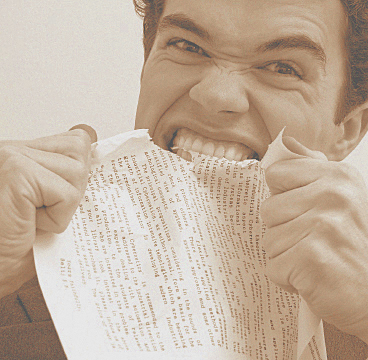Reviews sind wichtig, keine Frage. Oftmals macht der breite Blick auf’s Feld erst richtig klar, wo es wirklich steht — und viel wichtiger: welches die drängendsten offenen Fragen sind.
Reviews sind wichtig, keine Frage. Oftmals macht der breite Blick auf’s Feld erst richtig klar, wo es wirklich steht — und viel wichtiger: welches die drängendsten offenen Fragen sind.
Reviews können aber noch etwas anderes, eher unangenehmes: Zur falschen Zeit veröffentlicht, können sie die verdiente Anerkennung für so manchen Originalartikel deutlich schmälern. Und gerade in diesen Zeiten der Zitatezählerei kann das sehr unangenehm sein. Wie genau das geschehen kann, sei mit folgendem fiktiven Beispiel illustriert, in welches durchaus einige reale Muster und Begebenheiten hineinkondensiert wurden:
———————
[…] Das Feld war „heiß“, seit Jahren schon. Wer wirklich Neues zur regulatorischen RNAs in einem der Edel-Bätter publizieren konnte, durfte mit einem Haufen Zitierungen rechnen. Mehrere Hundert in den zwei bis drei folgenden Jahren waren üblich.
Nachwuchsgruppenleiter Müller war kurz davor. Die Resultate waren neu, eindeutig und bestätigt, das Manuskript gestern an Nature geschickt. Und insgeheim sah Müller schon allwöchentlich die Zahlen durch die Datenbank rattern: „Times cited: 23“, … „Times cited: 78“, … „Times cited: 145“, … „Times cited: 238“, …
Doch es gab etwas, das ihm ein wenig Sorgen machte. Rockman, der große, alte Emeritus und RNA-Pionier aus Berkeley, hatte ihn vor vier Wochen angerufen. Er schreibe einen Review für Cell, erzählte er ihm. Ob er nicht etwas Neues habe, das er ihm jetzt schon mitteilen könne — oder gar als „Draft“ schicken. Schließlich dauere es ja noch eine ganze Weile, bis der Review käme.
Müller war platt ob solcher Ehre. Dass Rockman ihn überhaupt kannte. DER Rockman, der in den letzten Jahren regelmäßig als heißer Kandidat für Stockholm gehandelt wurde. Fast schwindelig ob solcher Wertschätzung hatte sich Müller umgehend an den Rechner gesetzt und Rockman „mit besten Grüßen“ sein Manuskript gemailt.
Nature stellte sich quer. Ungewöhnlich lange dauerte es, bis Müller überhaupt etwas hörte. Und dann sollte er sogar noch ein paar Experimente nachliefern. Reine Gutachter-Schikane, fluchte er.
Müller schrieb nur geringfügig um und schickte das Manuskript stattdessen zu Science. Doch hier das gleiche Spiel. Absichernde Experimente forderten die Gutachter. Als ob die Sache nicht klar wäre. Aber was sollte er machen? Zwei Monate dauerte die „überflüssige“ Arbeit. Und Müller ärgerte sich. Verschwörungstheorien nahmen Gestalt an: „Ob Rockman…? Einfluss hat er ja… Ach Quatsch, der ist doch emeritiert.“
Als Müller schließlich vier Monate später das Science-Heft mit seinem Artikel in den Händen hielt, war aller Ärger weg geblasen. Jetzt also Zitierungen zählen. Nach zwei Monaten war er bereits bei 18, das war viel für die kurze Zeit. Nach vier Monaten waren es 26, — hm, na ja. Nach sechs Monaten waren es … immer noch nur 32? Was war los?
Rockmans Review war erschienen. Unerwartet schnell. Nur zwei Monate nach Müllers Paper. Eigentlich kein Wunder, denn Rockman war immer noch im Editorial Board von Cell. Der Review hatte alle Schlüsseldaten von Müller. Und die wurden jetzt bei Rockman zitiert. Wer kannte schon Müller, trotz frischem Science-Paper?
Zwei Jahre später schwebte der Rockman-Review satten 600 Zitierungen entgegen, Müllers Originalarbeit dümpelte immer noch bei unter 60 […]
———————
Ohne den Review wäre Müllers Originalarbeit sicher um einiges häufiger gelesen und zitiert worden — und sein Name hätte deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten. Gewichtige „Pfunde“, mit denen unser Nachwuchsgruppenleiter beim nächsten Karriereschritt gut hätte wuchern können. Ganz abgesehen davon, dass er sie sowieso verdient gehabt hätte.
Irgendwelche Anmerkungen dazu?
 __________________________
__________________________

 Und wieder ein Zitat aus einer E-Mail an unsere Redaktion. Ein Bio-Emeritus im aktiven Unruhestand prangert darin mit deutlichen Worten einige „Unsitten“ im aktuellen Forschungsbetrieb an:
Und wieder ein Zitat aus einer E-Mail an unsere Redaktion. Ein Bio-Emeritus im aktiven Unruhestand prangert darin mit deutlichen Worten einige „Unsitten“ im aktuellen Forschungsbetrieb an: Reviews sind wichtig, keine Frage. Oftmals macht der breite Blick auf’s Feld erst richtig klar, wo es wirklich steht — und viel wichtiger: welches die drängendsten offenen Fragen sind.
Reviews sind wichtig, keine Frage. Oftmals macht der breite Blick auf’s Feld erst richtig klar, wo es wirklich steht — und viel wichtiger: welches die drängendsten offenen Fragen sind. Letzte Woche traf ich einen Biotech-Unternehmer. Eher privat und „off the record“. Dennoch kamen wir im Gespräch irgendwann auf die Gründung seiner Firma, damals vor fast 15 Jahren. Und plötzlich sagte er:
Letzte Woche traf ich einen Biotech-Unternehmer. Eher privat und „off the record“. Dennoch kamen wir im Gespräch irgendwann auf die Gründung seiner Firma, damals vor fast 15 Jahren. Und plötzlich sagte er: