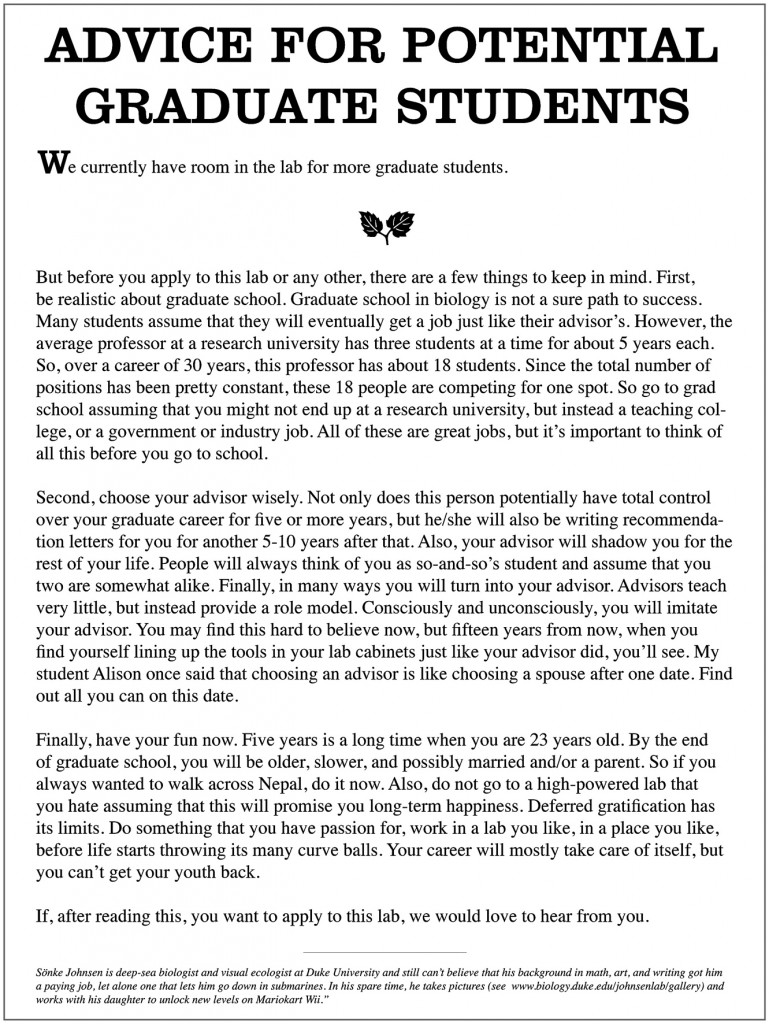Leider erlebt man das öfter: Viel Geld wird in großangelegte Forschungsinitiativen gepumpt — und am Ende kommt man den anvisierten Erkenntnissen damit doch deutlich weniger nahe als ursprünglich angekündigt.
Leider erlebt man das öfter: Viel Geld wird in großangelegte Forschungsinitiativen gepumpt — und am Ende kommt man den anvisierten Erkenntnissen damit doch deutlich weniger nahe als ursprünglich angekündigt.
Viele Paper wurden inzwischen geschrieben, die angeblich belegen, dass der „Impact pro Forscherkopf“ im Schnitt umso mehr sinkt, je größer das geförderte Gesamtprojekt ist (zum Beispiel hier und hier). Und jedes Mal arbeiteten die Autoren auch gewisse strukturelle und konzeptionelle Muster heraus, die solche „Underperformance“ von Big-Science-Projekten vermeintlich mitverursachen könnten. Diese zu referieren, wollen wir für heute jedoch anderen überlassen…
Hier soll es vielmehr um die Nörgler gehen, die bei der Ankündigung eines teuren Großprojekts inzwischen schon fast reflexartig aus ihren Löchern kommen und empört schreien: „Argh, so viel Geld für etwas, wo wahrscheinlich sowieso wieder nur vergleichsweise wenig rauskommt! Wie viele produktivere Small-Science-Projekte könnte man stattdessen damit finanzieren?“
Auweia! Als ob man immer schon vorher genau wüsste, welche Masse und Klasse an Erkenntnissen ein bestimmtes Projekt, ob groß oder klein, liefern kann. Und als ob man dann entsprechend punktgenau die billigstmögliche Förderung dafür kalkulieren könnte…
Klingt schon hier nicht mehr wirklich nach einem Forschungsprojekt, oder? Weil Forschung so eben nicht funktioniert. Gerade die Grundlagenforschung ist idealerweise ein Aufbruch ins Unbekannte. Man tastet sich sorgfältig in mehrere Richtungen vorwärts, landet immer wieder in Sackgassen, die auf den ersten Metern noch so vielversprechend und plausibel gewirkt hatten — und bekommt vielleicht irgendwann mal eine Ahnung von dem einen richtigen Pfad.
Natürlich rauft sich jeder Unternehmensberater ob solcher wackeliger „Kosten-Nutzen-Bilanzen“ die Haare. Aber würden gerade deren Methoden die Grundlagenforschung nicht in ihrem Kern zerstören? Und wäre dies am Ende nicht die schlechteste Bilanz von allen?
Zumal häufig vergessen wird: Gerade Großprojekt-Mittel sind immer auch fette Ausbildungsinvestitionen — nicht zuletzt, weil insbesondere in solchen Big-Science-Netzwerken oftmals ganz besonderer Wert darauf gelegt wird (siehe beispielsweise hier). Jede Menge Doktoranden und Co. lernen hierbei, wie Wissenschaft und Forschung tatsächlich funktionieren — auch, ja vielleicht sogar gerade auf den letztlich weniger erfolgreichen Pfaden.
Und wer weiß, liebe Nörgler, ob am Ende nicht ausgerechnet einer, der gestern in einem solchen „bilanzmiesen“ Projekt ausgebildet wurde, morgen den nächsten Mega-Durchbruch liefert? Ginge es nach euch, wäre er womöglich gar nicht erst bis dahin gekommen.
Ralf Neumann



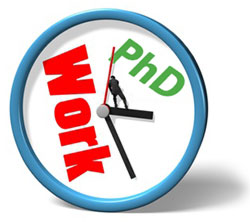 Wenn zum Beispiel eine TA aufgrund der Trägheit einiger Studenten das Praktikumslabor erst abends um 21:45 Uhr zuschließen kann, dann hat sie einen 14-Stunden-Tag hinter sich, da sie ja bereits morgens um 7:00 Uhr mit der Arbeit begonnen hatte. Das Zeiterfassungssystem honoriert diesen selbstlosen Einsatz für die Uni, indem es von den 14 Stunden einfach vier Stunden abzwackt, denn mehr als zehn Stunden pro Tag sind ja ‚verboten‘! Das macht aber nichts, denn ins elektronische Zeiterfassungssystem kann sich jede Angestellte einloggen und diese abgezwackten Stunden korrigieren, beziehungsweise sie sich anderswo wieder gutschreiben. Das muss dann allerdings schriftlich verfasst, ausgedruckt, vom Vorgesetzten gegengezeichnet und an die zentrale Verwaltung, Geschäftsbereich Personal, Referat ‚Zeiterfassung‘, gesandt werden. Es ist also reichlich Raum gegeben für verwaltungstechnische ‚Korrekturen’, weil die Verwaltung mit ihren vielseitigen Aufgaben ja total überlastet ist und das nicht auch noch alles kontrollieren kann. Daher wird erwartet, dass die Angestellten sich selbst kontrollieren (so, wie vor der Einführung des Erfassungssystems!) — ihre Zeiten also selbst erfassen und gegebenenfalls korrigieren.
Wenn zum Beispiel eine TA aufgrund der Trägheit einiger Studenten das Praktikumslabor erst abends um 21:45 Uhr zuschließen kann, dann hat sie einen 14-Stunden-Tag hinter sich, da sie ja bereits morgens um 7:00 Uhr mit der Arbeit begonnen hatte. Das Zeiterfassungssystem honoriert diesen selbstlosen Einsatz für die Uni, indem es von den 14 Stunden einfach vier Stunden abzwackt, denn mehr als zehn Stunden pro Tag sind ja ‚verboten‘! Das macht aber nichts, denn ins elektronische Zeiterfassungssystem kann sich jede Angestellte einloggen und diese abgezwackten Stunden korrigieren, beziehungsweise sie sich anderswo wieder gutschreiben. Das muss dann allerdings schriftlich verfasst, ausgedruckt, vom Vorgesetzten gegengezeichnet und an die zentrale Verwaltung, Geschäftsbereich Personal, Referat ‚Zeiterfassung‘, gesandt werden. Es ist also reichlich Raum gegeben für verwaltungstechnische ‚Korrekturen’, weil die Verwaltung mit ihren vielseitigen Aufgaben ja total überlastet ist und das nicht auch noch alles kontrollieren kann. Daher wird erwartet, dass die Angestellten sich selbst kontrollieren (so, wie vor der Einführung des Erfassungssystems!) — ihre Zeiten also selbst erfassen und gegebenenfalls korrigieren.
 Frauen sind in den oberen Rängen der Forschungshierarchie leider immer noch stark unterrepräsentiert. Gleichzeitig ist, zumindest in den Lebenswissenschaften, das Geschlechtsverhältnis unter den Studenten und sogar Doktoranden schon seit längerem gut ausbalanciert. Spätestens bei den Nachwuchswissenschaftlern aber, und erst recht unter Professoren wird die Männer-Dominanz überdeutlich. Dabei tun die Universitäten und andere Forschungseinrichtungen doch ihr Bestes, um mehr Frauen in Führungspositionen zu etablieren. Sie bieten beispielsweise Kinderbetreuung vor Ort an und weisen in jeder Ausschreibung auf die Bevorzugung von weiblichen Bewerberinnen hin. Warum schaffen es denn so wenige Frauen bis zur Professur? Eine kürzlich in
Frauen sind in den oberen Rängen der Forschungshierarchie leider immer noch stark unterrepräsentiert. Gleichzeitig ist, zumindest in den Lebenswissenschaften, das Geschlechtsverhältnis unter den Studenten und sogar Doktoranden schon seit längerem gut ausbalanciert. Spätestens bei den Nachwuchswissenschaftlern aber, und erst recht unter Professoren wird die Männer-Dominanz überdeutlich. Dabei tun die Universitäten und andere Forschungseinrichtungen doch ihr Bestes, um mehr Frauen in Führungspositionen zu etablieren. Sie bieten beispielsweise Kinderbetreuung vor Ort an und weisen in jeder Ausschreibung auf die Bevorzugung von weiblichen Bewerberinnen hin. Warum schaffen es denn so wenige Frauen bis zur Professur? Eine kürzlich in  Ende 2012 setzte die Max-Planck-Gesellschaft eine
Ende 2012 setzte die Max-Planck-Gesellschaft eine  Da die Aufgabe dieses Instituts — die Gefahreneinschätzung von Chemikalien, Lebensmitteln, Partikeln, etc. — sehr wichtig ist, werden potenzielle Job-Kandidaten entsprechend streng ausgewählt. Zumal diese Leute ja später auch verbeamtet werden sollen. Das Institut legt daher ganz besonderen Wert darauf, dass Wissenschaftler sich mit ihrem potenziellen Arbeitsgebiet sehr gut auskennen — am besten, schon bevor sie als Kandidaten überhaupt in Frage kommen.
Da die Aufgabe dieses Instituts — die Gefahreneinschätzung von Chemikalien, Lebensmitteln, Partikeln, etc. — sehr wichtig ist, werden potenzielle Job-Kandidaten entsprechend streng ausgewählt. Zumal diese Leute ja später auch verbeamtet werden sollen. Das Institut legt daher ganz besonderen Wert darauf, dass Wissenschaftler sich mit ihrem potenziellen Arbeitsgebiet sehr gut auskennen — am besten, schon bevor sie als Kandidaten überhaupt in Frage kommen.