


„Der Wahnsinn des Antragschreibens“ war Thema unseres letzten Postings unten. Zuvor hatten wir in unserer Heft-Kolumne „Inkubiert“ bereits einen ganz anderen Fall von „Antrags-Wahnsinn“ kommentiert (siehe LJ 1-2/2016). Wir bringen den Kommentar hier nochmals in überarbeiteter Form:
Wenn es um das Antragswesen wissenschaftlicher Projektförderung geht, scheint Effizienz oftmals kein hervorstechendes Merkmal zu sein. Zumindest bestärken einzelne Beispiele immer wieder diesen Eindruck.
Nehmen wir etwa den folgenden Fall, den der belgische Linguist Jan Blommaert in seinem Blog Ctrl+Alt+Dem beschrieb. Demnach ging er so richtig in die Vollen, als vor Monaten im EU-Rahmenprogramm „Horizon 2020“ ein bestimmtes Projektthema ausgeschrieben wurde. Umgehend stürzte er sich zusammen mit seinem Leuten in umfangreiche inhaltliche Vorarbeiten und heuerte überdies europaweit geeignete Partner für das geforderte „Internationale Konsortium“ an.
Logisch, dass für die notwendigen Meetings schnell mal Hunderte von Arbeitsstunden und mehrere Tausend Flugkilometer draufgingen. Ein Mitarbeiter aus Blommaerts Team kümmerte sich etwa monatelang quasi hauptamtlich um Koordination, Vorbereitung und schlussendliche Realisierung des Antrags. Dazu erhielt er umfassende Hilfe von zwei Leuten aus der Uni-Verwaltung: einem professionellen „Grant Writer“ und einem eigens angestellten Fachmann für EU-Angelegenheiten.
Dies alles und noch viel mehr summierte sich am Ende zu einem Riesenhaufen produktiver Zeit und Geld, die mit höchster Wahrscheinlichkeit völlig umsonst investiert — und damit verschwendet — waren. Denn eine Woche, nachdem sie den Antrag fix und fertig abgeschickt hatten, erhielten Blommaerts und Co. aus Brüssel die Nachricht, dass insgesamt 147 Anträge eingegangen seien, wovon jetzt ganze 2 — ZWEI! — bewilligt würden.
Man braucht keine allzu komplizierte Mathematik, um die hirnlose Ineffizienz dieses gesamten Manövers aufzuzeigen. Man multipliziere nur grob die ausschließlich mit Steuergeldern bezahlte Arbeitszeit samt übriger Kosten von Blommaert und Co. mit der Zahl der insgesamt 145 abgelehnten Anträge, addiere dazu die Brüsseler Kosten für Verwaltung und Begutachtung — und setze diese für nahezu Nix investierte Summe wiederum in Beziehung zu den 6 Millionen Euro Gesamt-Fördervolumen. Eine verheerende Bilanz, oder?
Und jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, welches Signal eine Ablehnungsquote von 98,7 Prozent für die Forscher generell bedeutet…
x
Wann sollte man einen Forscher besser nicht ansprechen? — Antwort: Wenn er gerade an einem Förderantrag schreibt.
„Immer wenn ich an einem Antrag arbeite, fühle ich mich wie ein verwundetes wildes Tier“, schrieb einmal sinngemäß ein Betroffener. „Sobald ich irgendwie nicht weiterkomme — und das passiert leider oft —, kauere ich voller Schmerzen in meiner Ecke. Mir wird heiß, ich atme schneller, beiße die Zähne zusammen und blicke mit gehetztem Blick um mich herum — auf der verzweifelten Suche nach Linderung durch die richtige Idee. Wenn dann jemand reinkommt und irgendetwas will, kann er schnell einen Finger verlieren oder sonst etwas — selbst wenn die betreffende Person sich nur Sorgen gemacht hat und mir helfen will.“
Okay, das ist sicher gnadenlos überspitzt. Wäre es tatsächlich jedes Mal so schlimm, müsste sich unser Forscher aus gesundheitlichen Gründen wohl besser bald einen anderen Job suchen. Dennoch dürfte sich jeder, dem das Antragschreiben nicht allzu leicht aus den Fingern fließt, darin prinzipiell wiedererkennen.
Das Dumme ist: Den Meisten fließen die Anträge nicht aus den Fingern. Und so sehen sie sich stets stärkeren „Qualen“ ausgesetzt, da die Frequenz des Antragsschreibens zuletzt immer mehr zugenommen hat.
Der US-Computerwissenschaftler Matt Welsh beispielsweise verließ vor einigen Jahren genau aus diesem Grund die Harvard University und arbeitet seitdem für Google. Er schrieb damals dazu in seinem Blog Volatile and Decentralized:
„Die größte Überraschung war, wie viel Zeit ich für die Finanzierung meiner Forschung aufbringen musste. Obwohl es natürlich variiert, schätze ich, dass ich etwa vierzig Prozent damit verbracht habe, irgendwelchen Fördermitteln hinterher zu jagen — Diesen Beitrag weiterlesen »
(Der gleiche Hochschullehrer — siehe Posting vom 29. April — hatte noch mehr über die deutschen Unis zu meckern:)
Die Verwaltungen der Unis wuchern mit autokatalytischer Rückkopplung, ähnlich wie ein Tumor. Mittlerweile wachsen gar Strukturen zur Verwaltung der Verwaltung. Ein Beispiel dafür ist die Verwaltung der Zeiterfassung, denn auch die Mitarbeiter der Verwaltung (und gerade die) sind im elektronischen Zeiterfassungssystem integriert — damit bloß niemand zu viel arbeitet. Dummerweise muss so ein elektronisches System auch gepflegt und kontrolliert werden — wofür wiederum Verwaltungstellen geschaffen wurden. Die Pflege und Kontrolle läuft aber ins Leere, denn es gibt ja ‚Spielräume‘.
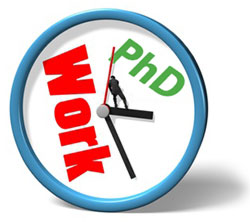 Wenn zum Beispiel eine TA aufgrund der Trägheit einiger Studenten das Praktikumslabor erst abends um 21:45 Uhr zuschließen kann, dann hat sie einen 14-Stunden-Tag hinter sich, da sie ja bereits morgens um 7:00 Uhr mit der Arbeit begonnen hatte. Das Zeiterfassungssystem honoriert diesen selbstlosen Einsatz für die Uni, indem es von den 14 Stunden einfach vier Stunden abzwackt, denn mehr als zehn Stunden pro Tag sind ja ‚verboten‘! Das macht aber nichts, denn ins elektronische Zeiterfassungssystem kann sich jede Angestellte einloggen und diese abgezwackten Stunden korrigieren, beziehungsweise sie sich anderswo wieder gutschreiben. Das muss dann allerdings schriftlich verfasst, ausgedruckt, vom Vorgesetzten gegengezeichnet und an die zentrale Verwaltung, Geschäftsbereich Personal, Referat ‚Zeiterfassung‘, gesandt werden. Es ist also reichlich Raum gegeben für verwaltungstechnische ‚Korrekturen’, weil die Verwaltung mit ihren vielseitigen Aufgaben ja total überlastet ist und das nicht auch noch alles kontrollieren kann. Daher wird erwartet, dass die Angestellten sich selbst kontrollieren (so, wie vor der Einführung des Erfassungssystems!) — ihre Zeiten also selbst erfassen und gegebenenfalls korrigieren.
Wenn zum Beispiel eine TA aufgrund der Trägheit einiger Studenten das Praktikumslabor erst abends um 21:45 Uhr zuschließen kann, dann hat sie einen 14-Stunden-Tag hinter sich, da sie ja bereits morgens um 7:00 Uhr mit der Arbeit begonnen hatte. Das Zeiterfassungssystem honoriert diesen selbstlosen Einsatz für die Uni, indem es von den 14 Stunden einfach vier Stunden abzwackt, denn mehr als zehn Stunden pro Tag sind ja ‚verboten‘! Das macht aber nichts, denn ins elektronische Zeiterfassungssystem kann sich jede Angestellte einloggen und diese abgezwackten Stunden korrigieren, beziehungsweise sie sich anderswo wieder gutschreiben. Das muss dann allerdings schriftlich verfasst, ausgedruckt, vom Vorgesetzten gegengezeichnet und an die zentrale Verwaltung, Geschäftsbereich Personal, Referat ‚Zeiterfassung‘, gesandt werden. Es ist also reichlich Raum gegeben für verwaltungstechnische ‚Korrekturen’, weil die Verwaltung mit ihren vielseitigen Aufgaben ja total überlastet ist und das nicht auch noch alles kontrollieren kann. Daher wird erwartet, dass die Angestellten sich selbst kontrollieren (so, wie vor der Einführung des Erfassungssystems!) — ihre Zeiten also selbst erfassen und gegebenenfalls korrigieren.
Die Uni Darmstadt (vertrauliche Mitteilung!) plant jetzt, die Zeiterfassung auch auf die wissenschaftlichen Mitarbeiter auszudehnen. Das verursacht natürlich großen Unmut, weil Zeiterfassung als Wissenschaftskiller gesehen wird. Warum eigentlich? Es ist doch alles halb so schlimm; es kommt, wie es kommt. Es wird zwar sehr viel mehr Bürokratie, aber einen Weg, das System zu den eigenen Gunsten zu ‚korrigieren‘, findet man immer, weil die Verwaltung an der von ihr selbst verursachten Bürokratie erstickt. Und ist die Zeiterfassung tatsächlich ein Wissenschaftskiller? Nein, nicht wirklich — denn einen Doktorand, der sich auf seine halbe Stelle beruft und meint, er dürfte aufgrund der Zeiterfassung nur 19,5 Stunden pro Woche im Labor stehen, den schmeißt man am besten gleich in den ersten Wochen der Probezeit wieder raus.
Die Lesart in solch einem Falle ist somit folgende: Der Doktorand MUSS 19,5 Stunden in der Woche für das arbeiten, wofür er bezahlt wird, und die übrigen 148,5 Stunden der Woche DARF er sich seiner Doktorarbeit widmen. Dabei hat das MUSS mit dem DARF bei DFG-finanzierten Doktoranden einen hundertprozentigen thematischen Überlapp, während der Überlapp bei Landesstellen-Doktoranden wegen abzuleistender Hilfsdienste in den Lehrveranstaltungen nur bei etwa 99 Prozent liegt. Ein braver ‚halber‘ Doktorand kommt also um 9:00Uhr, und stempelt sich dann pünktlich um 14:00 Uhr aus, um dann unverzüglich ins Labor zurückzukehren und bis 26:00 Uhr zeitunerfasst an seiner Doktorarbeit weiterzuarbeiten.
Und da heißt es, an der Uni herrschten Logik und Weisheit…

Wie bereits auf unserer Twitterseite gemeldet, erhielt unser Autor Axel Brennicke (Foto, Mitte) für seine regelmäßige Laborjournal-Kolumne „Ansichten eines Profs“ den „Science Hero Preis 2015“ der Konferenz Biologischer Fachbereiche (KBF). Die Preisverleihung nutzte die KBF jedoch nicht nur zur „Heldenverehrung“ — sondern nahm sie zugleich zum Anlass, um auch ihrerseits „einige Visionen zu formulieren, wie die Forschungs- und Hochschullandschaft der Zukunft aussehen könnte“. In ihrer Presseaussendung schreibt sie:
Die Konferenz Biologischer Fachbereiche ehrt Herrn Dr. Axel Brennicke, Professor für Molekulare Botanik der Universität Ulm, mit dem Science Hero Preis 2015. Die Vergabe des Science Hero Preises erfolgt an Personen oder Organisationen in der biowissenschaftlichen Forschung und Lehre, die bürokratische Ausuferungen oder politische Absurditäten mit Humor bekämpft, standhaft ertragen, oder effizient vermieden haben. Idealerweise haben die Preisträger dabei mehr Zeit und Ressourcen für gute Lehre und kreative Forschung verfügbar gemacht. Axel Brennicke ist für sein unermüdliches Engagement deutschlandweit bekannt und somit ein würdiger Preisträger 2015. Mit spitzer Feder hat er am Beispiel seiner Heimatuniversität die Absurditäten des deutschen Hochschulalltags im Laborjournal regelmäßig dargestellt. […]
Die Konferenz Biologischer Fachbereiche nimmt die Preisverleihung zum Anlass, um einige Visionen zu formulieren, wie die Forschungs- und Hochschullandschaft der Zukunft aussehen könnte.
Vision 1: Jeder Hochschulangehörige kann sich den eigenen Neigungen und Fähigkeiten in Wissenschaft und Lehre widmen. Verwaltung und Qualitätsmanagement werden als Serviceleistung für die Fakultäten verstanden. Die Lehre ist ausreichend finanziert und nicht auf Quersubventionierung oder Selbstausbeutung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern angewiesen.
Vision 2: Die Grundlagenforschung genießt in der Öffentlichkeit eine hohe Wertschätzung. Antragstellung und Abwicklung von Projekten für Forschung und Lehre werden professionell unterstützt. Die Projektvergabe erfolgt transparent und zeitnah. Drittmittel werden nach Maßgabe der Antragsteller eingesetzt, auch hinsichtlich der Stellenvergabe. Projektträger und Hochschulleitungen haben sich von ihrem Rollenbild als Kontrollinstanzen verabschiedet und sehen ihre Kernfunktion als Unterstützer von Wissenschaft und Lehre.
Vision 3: Halbherzige Bildungsreformen, widersinnige Befristungsregeln und chronische Unterfinanzierung sind überwunden. Es gibt ein verlässliches und stabiles Hochschulrahmengesetz. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist grundlegend reformiert und in einen Wissenschaftstarifrahmen eingebunden. Besoldungsregeln sind transparent und orientieren sich nach einem vergleichbaren Schema. Karrierepläne für den wissenschaftlichen Nachwuchs sind Bestandteil eines verbindlichen und ausfinanzierten Personal-Entwicklungskonzepts.
Vision 4: Der Wildwuchs an Studiengangsbezeichnungen ist durch systematische Kategorisierung der angebotenen Curricula nach Fach-Inhalten und Harmonisierung der grundständigen Studiengänge eingedämmt. Studierende haben viele Wahlmöglichkeiten, wissen und verstehen, was sie im Studium erwartet und können leicht zwischen Studienorten wechseln. Das Studium bringt Fachkompetenz, fördert die Persönlichkeitsentwicklung und bewirkt hohe berufliche Erfolgschancen.
Vision 5: Der Regularien-Dschungel ist durch ein vereinheitlichtes Gesetzbuch gelichtet. Biologische Materialien werden nach ihrem Gefährdungspotential beurteilt – unabhängig von der Art ihrer Erzeugung. Der verantwortungsvolle Umgang mit biologischen Einheiten ist auch für neue Technologien geregelt und sichergestellt.
Kurz vor der Preisverleihung schrieb uns Axel Brennicke noch:
Den hole ich dann stellvertretend für die ganze Redaktion ab. Mal sehen, was es für uns Helden gibt…
Es gab diese, von dem Hallenser Künstler Bernd Göbel entworfene „Helden“-Skulptur:

(Sämtliche „Ansichten eines Profs“ seit 2004 gibt es übrigens hier auf Laborjournal online.)
(Hin und wieder stöbern wir in unseren eigenen alten Ausgaben — und stoßen dabei bisweilen auf zeitlose „Perlen“, die das Gros unserer heutigen Leser nicht kennt. Zum Beispiel der folgende Beitrag aus dem Jahr 2000:)
Unis, Professoren, Disziplinen — alle werden mannigfach evaluiert. Außer den Forschungsförderern. Warum die eigentlich nicht?
 Rationales Vorgehen ist nicht jedermanns Sache — das gilt leider auch für einige Wissenschaftler. Ein Beispiel: Auf einen Bericht der Zeitschrift Nature über Mängel in der Förderpraxis der DFG hin fühlten sich einige langjährige Drittmittelempfänger berufen, mit einer E-Mail-Kettenbrief-Keule auf die Zeitschrift einzudreschen (vgl. LJ 5/2000, S. 18). Vielleicht verklagen die Herren auch den Netzgeräte-Hersteller, wenn auf dem Gel nicht die richtigen Banden zu sehen sind? Spaß beiseite: Die Mitarbeiter und Gutachter der DFG oder des BMBF sollten dankbar für derartige Berichte sein. Sie kennen ja die Probleme des Hochschullehrer-Nachwuchses nicht aus eigener Erfahrung. Sie sollten Berichte aus der „Unterwelt“ als wertvollen Hinweis betrachten. Genau wie der Forscher jene ärgerliche zusätzliche Bande auf dem Gel akzeptieren muss, die einfach nicht wegzureinigen ist — und sich dann als essentieller Kofaktor erweist.
Rationales Vorgehen ist nicht jedermanns Sache — das gilt leider auch für einige Wissenschaftler. Ein Beispiel: Auf einen Bericht der Zeitschrift Nature über Mängel in der Förderpraxis der DFG hin fühlten sich einige langjährige Drittmittelempfänger berufen, mit einer E-Mail-Kettenbrief-Keule auf die Zeitschrift einzudreschen (vgl. LJ 5/2000, S. 18). Vielleicht verklagen die Herren auch den Netzgeräte-Hersteller, wenn auf dem Gel nicht die richtigen Banden zu sehen sind? Spaß beiseite: Die Mitarbeiter und Gutachter der DFG oder des BMBF sollten dankbar für derartige Berichte sein. Sie kennen ja die Probleme des Hochschullehrer-Nachwuchses nicht aus eigener Erfahrung. Sie sollten Berichte aus der „Unterwelt“ als wertvollen Hinweis betrachten. Genau wie der Forscher jene ärgerliche zusätzliche Bande auf dem Gel akzeptieren muss, die einfach nicht wegzureinigen ist — und sich dann als essentieller Kofaktor erweist.
Methoden wie im Mittelalter
Wie geht man Probleme rational an? Es gibt eine alte Regel, die schon die Römer kannten, vermutlich sogar schon die Neandertaler: Man macht sich zuerst ein Bild über die Lage, dann erst trifft man Entscheidungen. Hier: man sammelt zuerst Daten. Auch Firmen ermitteln zuerst, wo der Markt ist und was die Zielgruppe braucht — vorher wird nicht investiert.
Wie aber packen unsere Forschungsförderer die Probleme an? Diesen Beitrag weiterlesen »

Watson und Crick haben Spaß mit ihrem Spielzeug.
Seit mindestens zwei Jahrzehnten scheint die Wissenschaftspolitiker in unserer ökonomisierten Welt vor allem eine Frage umzutreiben: Wie kriegen wir am meisten raus aus unseren Forschern?
Und tatsächlich versuchten sie ja so auch einiges an den Drehschrauben des „Systems“. „Mehr Wettbewerb“ war beispielsweise eine Formel — und man schuf damit… mehr Bürokratie.
„Stärkere Vernetzung“ war eine weitere. Was man bekam, war jedoch, dass die Brillanten mit vielen Mittelmäßigen gleichgeschaltet wurden und ihre Zeit und Energie in unzähligen ergebnisarmen Koordinationstreffen vertrödeln mussten.
„Stärkere Konzentration auf Zukunftsthemen“ war auch ein beliebtes Rezept. Was man bekam, waren Schlagworte und Um-Etikettierungen. Der Wurm-Genetiker machte plötzlich „Molekulare Medizin“; und der Membranbiochemiker studierte weiterhin denselben Bindekomplex, nur nannte er es jetzt „Proteomik“.
Und sogar die Architektur wurde bisweilen bemüht, weil doch angeblich in hellen und luftigen Labors die Gedanken besonders hoch fliegen.
Doch hat sich bei alledem eigentlich mal jemand gefragt, wie gute Forscher als Menschen sind und was sie wirklich am meisten wollen. Sicher, man kann sie kaum über einen Kamm scheren — aber wenigstens zeigt die Wissenschaftsgeschichte doch einige Tendenzen:
Gute Forscher sind getrieben von einer bohrenden Neugierde, die sich trotz aller analytischen Sachlichkeit oftmals mit nahezu naiver Fröhlichkeit und ungehemmtem — ja, man kann sagen — Spieltrieb Bahn bricht. Was über die notwendigsten Bedürfnisse des täglichen Lebens hinausgeht, steht dahinter klar zurück — weshalb der Forscher in aller Regel zur anspruchslosesten Subspezies des Homo sapiens überhaupt gehört.
Für sich selbst braucht der Forscher folglich kaum Geld (wohl aber für die Realisierung der Projekte zur Befriedigung seiner Neugier). Weitaus wichtiger ist ihnen hingegen ihre Unabhängigkeit, gewürzt mit einer ordentlichen Prise Humor — Albert Einstein, Francis Crick oder Sydney Brenner sind gute Beispiele. Und wie oft umgibt ihre brillanten Ideen eine Aura von Leichtigkeit — beispielsweise die Modellbasteleien von Watson und Crick, oder Kary Mullis’ PCR-Geistesblitz während einer langen Autofahrt durch grandiose Landschaften.
Fröhliche Neugier, Unabhängigkeit, Spieltrieb, Humor, Spaß und Leichtigkeit also. Man hat den Eindruck, dass die Verdrehungen des Systems den Forschern zuletzt all dies eher genommen haben.

Neulich klingelte das Telefon in der Laborjournal-Redaktion. Sicher, das passiert ziemlich oft — in diesem speziellen Fall jedoch kam der Anrufer ohne Umschweife zur Sache (was wiederum nicht ganz so oft passiert):
„Ihr müsst unbedingt mal was über Tierversuchsanträge machen. Da steckt eine dermaßen aufgeblasene Bürokratie dahinter, die zudem teilweise von ziemlich selbstherrlich agierenden Tierschutzbeauftragten verwaltet wird — das ist insgesamt sowas von forschungsfeindlich. Das würden bestimmt jede Menge Leute unterschrieben, die damit zu tun hatten.“
„Okay“, antwortete unser Redakteur, „können Sie mir mal ein Beispiel geben? Nur damit das Ganze für mich etwas anschaulicher wird.“ Diesen Beitrag weiterlesen »