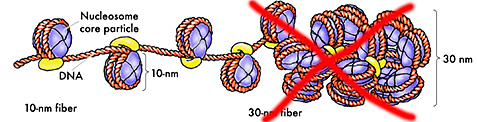(Im Zusammenhang mit den „Vertrackten Artefakten“ [siehe letzter Post unten] fiel uns ein, dass wir bereits vor knapp zwei Jahren das unten folgende Online-Editorial zu diesem Thema gebracht hatten. Allerdings ging es darin weniger um die beiden geschilderten Artefakte an sich, als vielmehr darum, wie unterschiedlich die Folgen für die Betroffenen sein können, wenn sie aus Unwissenheit darauf reinfallen…)
 Aus Fehlern lernt man, heißt es. Doch gilt das auch in der Forschung? Hat der immer engere Wettbewerb um Stellen und Fördermittel nicht mittlerweile dafür gesorgt, dass das Forschungsgeschäft mit Fehlern ziemlich gnadenlos umgeht? Auch weil jede kleine Nachlässigkeit oder Schlamperei der wachsamen Konkurrenz potentielle und willkommene Angriffsflächen bietet? Und wenn ja: Muss ein solcher „Geist“ nicht vor allem auf Kosten des wissenschaftlichen Nachwuchses gehen, der ja auch — vielleicht sogar gerade — durch Fehler lernen sollte?
Aus Fehlern lernt man, heißt es. Doch gilt das auch in der Forschung? Hat der immer engere Wettbewerb um Stellen und Fördermittel nicht mittlerweile dafür gesorgt, dass das Forschungsgeschäft mit Fehlern ziemlich gnadenlos umgeht? Auch weil jede kleine Nachlässigkeit oder Schlamperei der wachsamen Konkurrenz potentielle und willkommene Angriffsflächen bietet? Und wenn ja: Muss ein solcher „Geist“ nicht vor allem auf Kosten des wissenschaftlichen Nachwuchses gehen, der ja auch — vielleicht sogar gerade — durch Fehler lernen sollte?
Nehmen wir etwa den jungen Doktoranden M. Dieser versuchte vor einiger Zeit ein bestimmtes Membranprotein zu isolieren — und hatte offenbar Erfolg: Nach monatelanger „Putzerei“ präsentierte er in der entscheidenden Bahn des Proteingels eine Bande — und sonst keine. Chef und Doktorand zweifelten nicht: Das musste es sein. Zumal nach der heiligen Regel „n ≥ 3“ dieselbe Bande auch in den folgenden Wiederholungen zuverlässig übrig blieb.
Chef und Doktorand schrieben also ein Paper. Es wurde begutachtet und schließlich publiziert. Was dummerweise weder Doktorand noch Chef oder Gutachter wussten (letztere waren wohl schon zu lange „weg von der Bench“), fiel erfahrenen Proteinfärbern sofort auf: Die Bande entsprach exakt dem 68 kDa-Artefakt, das man oft nach Mercaptoethanol-Behandlung der Proteinprobe erhält.
Nur zwei Monate nach dessen Erscheinen zerpflückte Chefs Erzrivale das Paper in einer „Correspondence“ mit klarem Artefakt-Beweis. Frustriert und voller Scham schmiss M. seine Doktorarbeit hin.
Bei aller Härte am Ende doch gut für die Wissenschaft? Vielleicht.
Allerdings geht es auch ganz anders — wie das Beispiel der Doktorandin K. beweist, der einst ganz Ähnliches widerfuhr. Diese fiel auf ein Artefakt herein, das Ungeübten oft bei der Aufnahme neuronaler Signale mit Multielektrodenarrays droht. Und auch sie hatte ihre Ergebnisse frisch publiziert. Kurz darauf meldete sich einer der „Großkönige“ der neuronalen Ableitung telefonisch bei K.: „Gratuliere zum Paper. Allerdings scheint mir ein Schlüsselbefund nicht zu stimmen. Ich habe meinen Postdoc das Experiment nachmachen lassen — und er meint, Du hättest bei der Elektrodenmessung was vergessen…“
Sein Postdoc wiederum habe jedoch Wichtigeres zu tun, erklärte er weiter — weshalb es besser sei, wenn K. ihren Fehler selbst nachweisen würde. Anschließend weihte der Anrufer K. noch in einige weitere Geheimnisse und Fallstricke bei der Arbeit mit den entsprechenden Elektroden ein und skizzierte überdies noch, wie sie die „Richtigstellung“ seiner Meinung nach am geschicktesten angehen könne.
K. tat wie vorgeschlagen und veröffentlichte bald darauf die „Correction“ ihres eigenen Papers. Heute, über zwanzig Jahre später, gilt sie als herausragende Forscherin in ihrem Feld.
Wer weiß, so weit hätte M. womöglich auch kommen können…
Ralf Neumann
(Anmerkung: Die beiden Beispiele von K. und M. haben sich zwar nicht ganz genau so abgespielt, wie hier beschrieben — aber prinzipiell doch sehr ähnlich.)
x