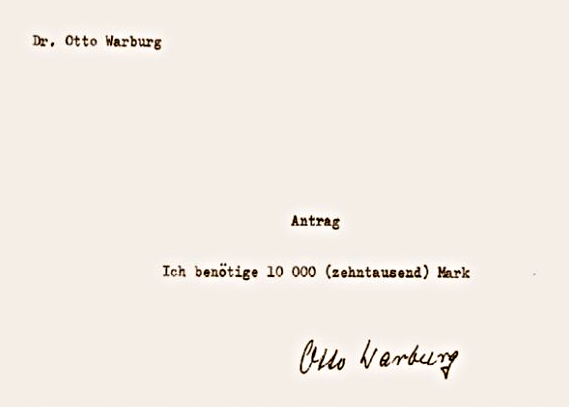x
Neulich in der Redaktion:…
K: „Du, ich hab‘ gerade erst dein Online-Editorial von vor drei Wochen gelesen. Das über das Scheitern von Doktoranden.“
N: „Ja, und?“
K: „Du weißt schon — das über den Typen, der sich ewig lang die Zähne an einer Proteinreinigung ausgebissen hat.“
N: „Ja, ja — schon klar. Aber was willst du mir sagen? Ist irgendwas falsch?“
 K: „Nein, darum geht es nicht. Aber der arme Kerl hat doch nach allen Regeln der Kunst jede verfügbare Methode genutzt, hat sich sogar völlig neue Kniffe ausgedacht, um die Nuss zu knacken.“
K: „Nein, darum geht es nicht. Aber der arme Kerl hat doch nach allen Regeln der Kunst jede verfügbare Methode genutzt, hat sich sogar völlig neue Kniffe ausgedacht, um die Nuss zu knacken.“
N: „Genau, so steht’s in dem Artikel. Nur hat ihm das nix genutzt. Er hat die Nuss nicht geknackt, weil es mit dem gesamten Methodenarsenal zu dieser Zeit einfach nicht ging. War eben auch ein riskantes Projekt.“
K: „…Also hat er eines Tages frustriert die Doktorarbeit hingeschmissen und der Forschung komplett den Rücken gekehrt.“
N: „Ja, war ein echter Fall. Ist wirklich passiert. Und abgesehen davon wahrscheinlich weit öfter als nur einmal.
K: „Sicher. Aber jetzt überleg‘ doch mal weiter. Der Typ muss doch im Laufe dieser Jahre zu einem wahren Experten im Proteinaufreinigen geworden sein. Und damit regelrecht prädestiniert für höhere Aufgaben — für die ganz harten Knacknüsse, für die echt heftigen Projekte! Viele seiner „erfolgreichen“ Doktoranden-Kollegen kochen dagegen irgendwas mit einer 08/15-Methode, mit der auf jeden Fall was rauskommt — et voilà: Gratuliere, akademischer Grad!“
N: „Tja, genau den hat unser Verlierer aber leider nicht.“
K: „Dennoch: Sagen wir mal, ich wäre Chef einer kleinen Biotech-Firma, oder so etwas. Wenn Du mich fragst, wen ich als Mitarbeiter einstellen würde — einen „Stur-nach-einer-Methode-Kocher“ mit Doktortitel oder diesen „gescheiterten“ Pechvogel, der alles Mögliche probiert hat —, meine Antwort wäre ja sowas von klar…“
N: „Hm, da ist sicher was dran. Mal abgesehen davon, dass unser Pechvogel trotz fehlender Resultate echtes wissenschaftliches Arbeiten am Ende viel tiefer erfahren und gelernt haben dürfte als seine Kollegen, die mit einem „Die-Methode-bringt-mich-sicher-um-die-nächste-Ecke“-Projekt allzu glatt durchflutschen.“
K: „Eben… Was hat der gescheiterte Doktorand danach eigentlich gemacht? Weißt du das?“
N: „Der hat es dann noch geschafft, Lehrer zu werden.“
x

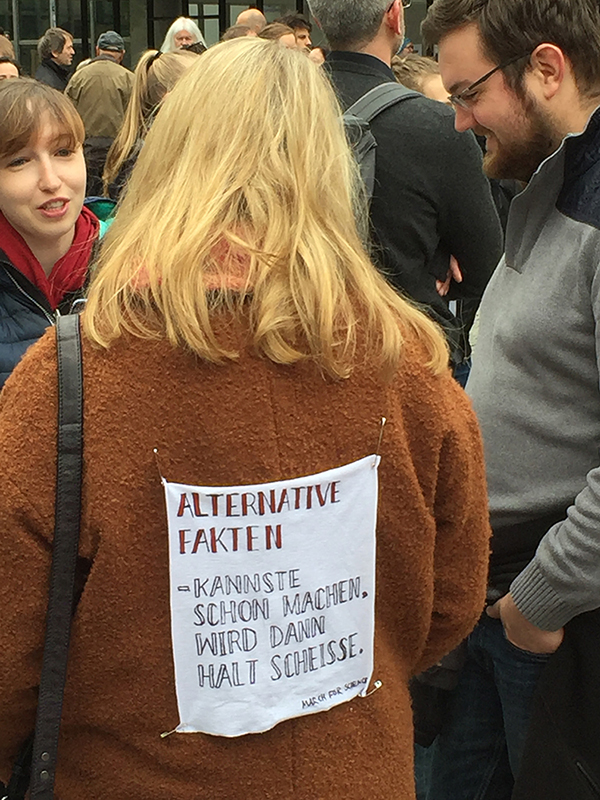


 K: „Nein, darum geht es nicht. Aber der arme Kerl hat doch nach allen Regeln der Kunst jede verfügbare Methode genutzt, hat sich sogar völlig neue Kniffe ausgedacht, um die Nuss zu knacken.“
K: „Nein, darum geht es nicht. Aber der arme Kerl hat doch nach allen Regeln der Kunst jede verfügbare Methode genutzt, hat sich sogar völlig neue Kniffe ausgedacht, um die Nuss zu knacken.“