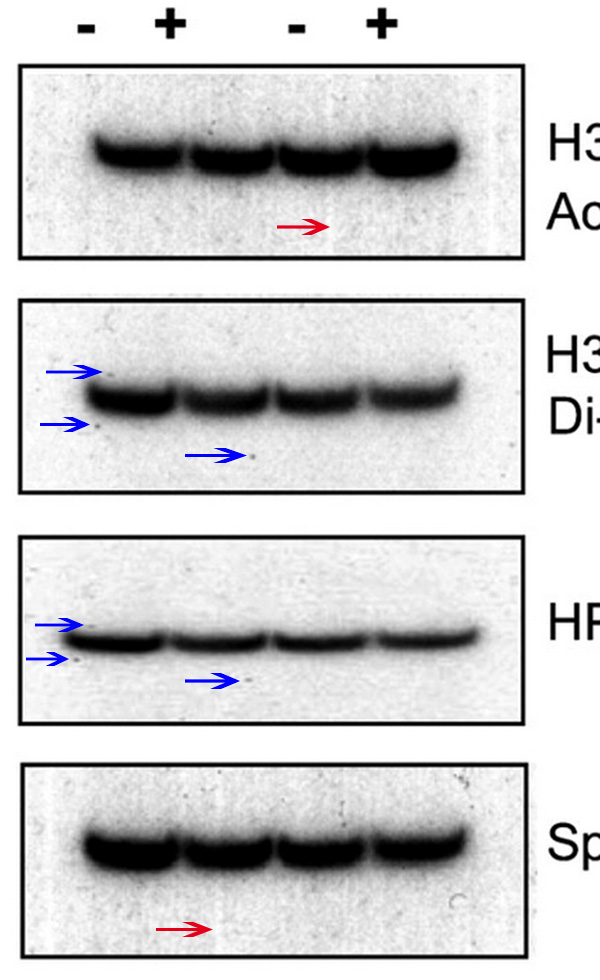Schau mal an! Wieder eine E-Mail eines… — nun ja, verärgerten Nachwuchsforschers. Beschwert sich, dass er nicht als Co-Autor mit auf das jüngste Paper seiner Gruppe genommen wurde. Totaler Skandal, weil er das natürlich klar verdient gehabt hätte — mehr noch als der konkrete Zweitautor. Ob wir das nicht öffentlich machen könnten. Solches Unrecht gehöre schließlich mal an den Pranger gestellt. Und nein — ihm selbst könne nix mehr passieren, da er inzwischen die Gruppe gewechselt habe. Aber sauer sei er natürlich immer noch…
Schau mal an! Wieder eine E-Mail eines… — nun ja, verärgerten Nachwuchsforschers. Beschwert sich, dass er nicht als Co-Autor mit auf das jüngste Paper seiner Gruppe genommen wurde. Totaler Skandal, weil er das natürlich klar verdient gehabt hätte — mehr noch als der konkrete Zweitautor. Ob wir das nicht öffentlich machen könnten. Solches Unrecht gehöre schließlich mal an den Pranger gestellt. Und nein — ihm selbst könne nix mehr passieren, da er inzwischen die Gruppe gewechselt habe. Aber sauer sei er natürlich immer noch…
Etwa ein Dutzend solcher E-Mails bekommen wir im Jahr. Einige Male haben wir tatsächlich nachgefragt. Und stets war „der Fall“ kaum objektiv darstellbar. Bisweilen schien es sogar ziemlich plausibel, warum der „Kläger“ letztlich nicht mit auf dem besagten Paper stand.
Dabei werden offenbar tatsächlich die Nachwuchsforscher vom Postdoc bis zum Master-Studenten mit am ehesten aus den Autorenlisten draußen gelassen. Zumindest war dies eines der Ergebnisse einer Umfrage der beiden US-Soziologen John Walsh und Sahra Jabbehdari aus dem Jahr 2017. Und die hatten dazu in den USA einige Leute mehr befragt als wir hier: Am Ende konnten sie die Angaben von 2.300 Forschern zu deren eigenen Publikationen auswerten (Sci. Technol. Human Values 42(5): 872-900).
Machen wir’s kurz:
» Nach Walsh und Jabbehdari listete ein Drittel der Artikel aus Biologie, Physik und Sozialwissenschaften mindestens einen „Gastautor“ mit auf, dessen Beitrag die Anforderungen für eine Co-Autorenschaft eigentlich nicht erfüllte. Angesichts von Ehren- und Gefälligkeits-Autorschaften wie auch ganzen Co-Autor-Kartellen war ein solch hoher Anteil womöglich zu erwarten.
» Viel erstaunlicher dagegen mutet jedoch der noch höhere Anteil an Artikeln an, auf denen ein oder mehrere Co-Autoren verschwiegen wurden, die wegen ihres Beitrags zur Studie eigentlich mit aufgelistet gehört hätten. Die befragten Forscher gaben an, dass hinter ganzen 55 Prozent ihrer Artikel noch mindestens ein weiterer „Geister-Autor“ gestanden hätte. Biologie und Medizin lagen genau in diesem Schnitt, während Ingenieurs-, Umwelt- und Agrarwissenschaften noch deutlich höher lagen. Den niedrigsten Anteil an „Geister-Autoren“ ermittelten die Verfasser mit 40 Prozent für die Mathematik und Computerwissenschaften.
» Und wer wurde hierbei bevorzugt „verschwiegen“? Neben Technischen Angestellten interessanterweise eher Postdocs als „Graduate Students“, also Doktoranden und Master-Studenten. In der Medizin lag der Anteil der Postdocs unter den „Verschwiegenen“ etwa bei 28 Prozent gegenüber 16 Prozent „Graduate Students“; in der Biologie betrug dasselbe Verhältnis 21 gegenüber 15 Prozent.
In der Summe heißt das also, dass in den Autorenzeilen jeder fünften Veröffentlichung aus den Medizin- und Biowissenschaften mindestens ein Nachwuchsforscher fehlt, der die Nennung eigentlich verdient gehabt hätte. Sicher lässt sich einwerfen, dass die gleiche Befragung in Europa womöglich andere Zahlen liefern würde. Aber würden Sie, liebe Leser, eine Voraussage wagen, in welche Richtung sich die geschilderten US-Verhältnisse dann verschieben könnten?
Wir meinen, angesichts der Bedeutung, die Co-Autorenschaften heutzutage für wissenschaftliche Karrieren haben, liefern bereits die US-Zahlen alleine ziemlich verstörende Erkenntnisse. Und für uns daher ein Grund mehr, um E-Mails wie der oben erwähnten tatsächlich nachzugehen.
Ralf Neumann


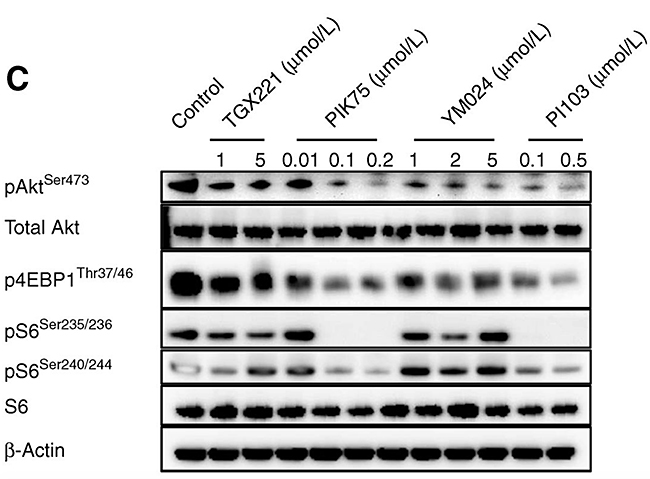
 Mitarbeiter der Annals of Internal Medicine stellten vorletzte Woche auf dem
Mitarbeiter der Annals of Internal Medicine stellten vorletzte Woche auf dem  „Ich bin Postdoc an der Uni […], und derzeit von Drittmitteln bezahlt […], die Ende 2017 auslaufen. Daher habe ich mich im März auf eine Stelle […] beworben, die als „Full time tenure-track research position […]“ ausgeschrieben war. Für die Bewerbung musste man neben dem CV auch einen Research Plan beilegen, der ein für die folgenden Jahre anvisiertes Forschungsprogramm überzeugend darlegt.
„Ich bin Postdoc an der Uni […], und derzeit von Drittmitteln bezahlt […], die Ende 2017 auslaufen. Daher habe ich mich im März auf eine Stelle […] beworben, die als „Full time tenure-track research position […]“ ausgeschrieben war. Für die Bewerbung musste man neben dem CV auch einen Research Plan beilegen, der ein für die folgenden Jahre anvisiertes Forschungsprogramm überzeugend darlegt.
 Und wieder ein Zitat aus einer E-Mail an unsere Redaktion. Ein Bio-Emeritus im aktiven Unruhestand prangert darin mit deutlichen Worten einige „Unsitten“ im aktuellen Forschungsbetrieb an:
Und wieder ein Zitat aus einer E-Mail an unsere Redaktion. Ein Bio-Emeritus im aktiven Unruhestand prangert darin mit deutlichen Worten einige „Unsitten“ im aktuellen Forschungsbetrieb an: Schon seit einiger Zeit muss der Zürcher Pflanzenforscher
Schon seit einiger Zeit muss der Zürcher Pflanzenforscher  Über eine Reform des Peer Review-Systems lässt sich trefflich streiten. Ein immer wieder ins Feld geführtes Argument gegen den klassischen Peer Review ist jedoch nicht ganz fair: Dass die Zunahme getürkter Paper in der Forschungsliteratur doch zeige, wie unzulänglich die Begutachtung funktioniert. Beispielsweise in diesem
Über eine Reform des Peer Review-Systems lässt sich trefflich streiten. Ein immer wieder ins Feld geführtes Argument gegen den klassischen Peer Review ist jedoch nicht ganz fair: Dass die Zunahme getürkter Paper in der Forschungsliteratur doch zeige, wie unzulänglich die Begutachtung funktioniert. Beispielsweise in diesem