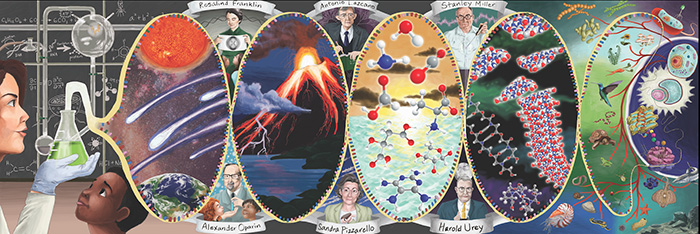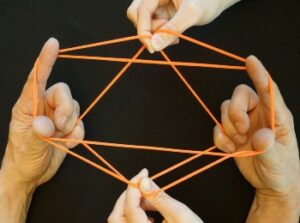… Zeit, den Pandemie-Winter abzuschütteln, das Fenster aufzureißen und das Frühjahr tief in die Lungenflügel zu saugen. Oh, wer liebt nicht diesen Frühlingsduft von Schneeglöckchen, Narzissen und Krokussen, der an vergangene Picknicks erinnert und auf laue Sommerabende hoffen lässt. Macht es Ihnen nicht auch direkt gute Laune, wenn dieses ganz bestimmte Aroma frisch gemähten Rasens in der Luft liegt?
Doch im Gegensatz zu Ihrer Hochstimmung ist dieser Duft eigentlich ein Zeichen der derzeitigen Übellaunigkeit Ihrer Grünfläche. Entkommen kann sie der mähwütigen Kleingärtnerschar schließlich nicht. Ohnmächtig bleibt ihr nur eines: ein chemisches SOS abzusetzen. Was dem Rasenmähermann und der Rasenmäherfrau dann in die Nasenhöhlen strömt, ist ein wahrer Cocktail an Alkoholen und Aldehyden. Einem Großalarm gleich metabolisieren verletzte Grünpflanzen nämlich α-Linolensäure mithilfe von Lipoxygenasen und Hydroperoxidlyasen zu flüchtigem cis-3-Hexenol – aka „frisch gemähtem Gras“ – und reduzieren, isomerisieren und verestern es alsdann zu einer Vielfalt grüner Blattduftstoffe.
Natürlich macht Ihre Rasenfläche das nicht Ihres Schreberglücks wegen, sondern aus Überlebensgründen. Der chemische SOS-Ruf warnt nicht nur Pflanzenkumpane in der Nachbarschaft und wirkt toxisch auf Pilze und Bakterien, sondern wehrt fressgierige Herbivoren ab. Denn Hexenol-Derivate locken parasitierende Schlupfwespen an, die ihre Eier unter anderem in gefräßige Insekten-Larven legen. Während das für die Pflanzenschädlinge den Tod bedeutet, hilft es gegen Ihre eiserne Rasenmähermaschinerie natürlich nicht. Beim nächsten Grünflächen-Stutzen denken Sie daran, dass das Duftbouquet keine persönliche Einladung an Sie zum Verweilen ist, sondern Ihre Wiese Sie gerade als Fressfeind ächtet. Diesen Beitrag weiterlesen »

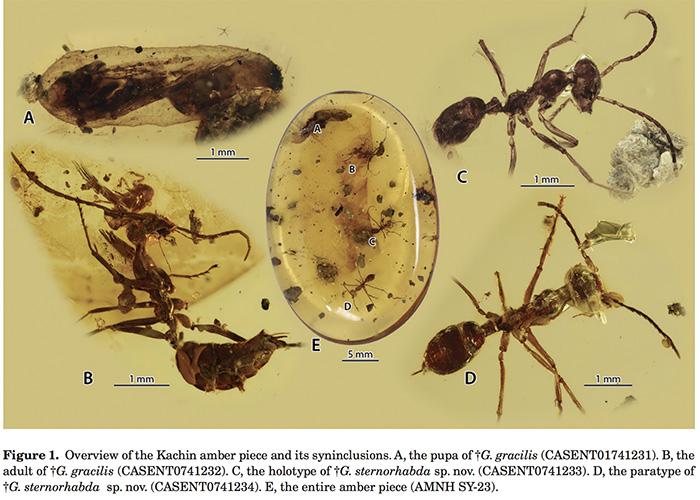


 Immer wieder schön, wenn neue Ergebnisse vermeintlich lange etablierte Erkenntnisse mit einem Mal vom Kopf auf die Füße stellen.
Immer wieder schön, wenn neue Ergebnisse vermeintlich lange etablierte Erkenntnisse mit einem Mal vom Kopf auf die Füße stellen.