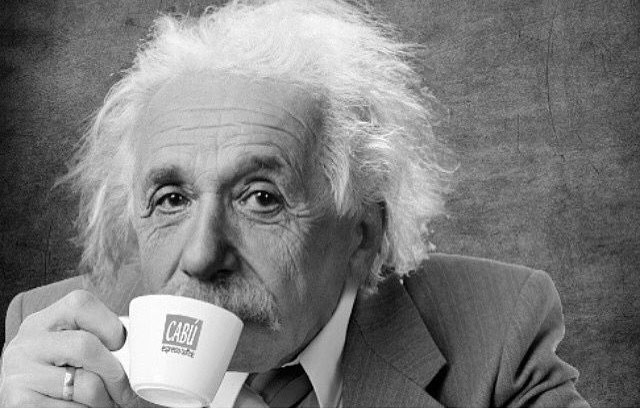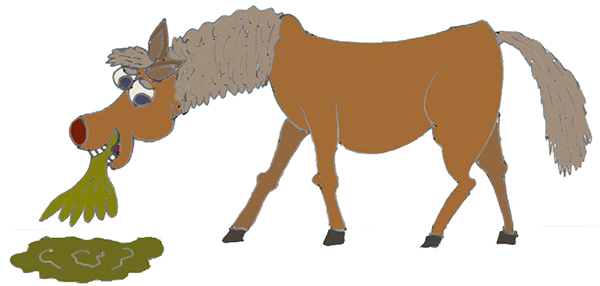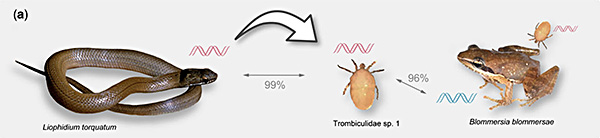Vor etwa zehn Jahren konnte man in dem Essay eines Forschers [Name und Referenz leider entfallen] sinngemäß folgenden Vorwurf lesen:
„Immer ausgefuchster und kraftvoller werden unsere Methoden, aber was machen wir daraus? Gerade unsere wissenschaftlichen Edelblätter sind voll von Studien, die mit immer umfassenderen Analysen und schöneren Bildchen am Ende doch nur bereits Bekanntes zeigen. Weil es jetzt eben geht. Zugegeben, die Resultate schauen damit oftmals deutlich eindrucksvoller aus. Aber wirklich neue Erkenntnisse liefert die neue Methoden-Power auf diese Weise nicht.“
Da ist sicher was dran. Aber genauso sicher ist es nur die halbe Wahrheit. Oft genug enthüllt der „größere Blick“ auf Altbekanntes mit nunmehr besseren Werkzeugen tatsächlich bislang Verborgenes – das vielleicht nicht immer gleich neue Erkenntnisse liefert, aber zumindest den Weg zu neuen Fragen eröffnet.
Schauen wir uns vor diesem Hintergrund das folgende Zitat aus einer Pressemeldung der Johns Hopkins University in Baltimore, USA, an:

„Aus jahrzehntelanger Forschung zur Proteinfaltung wissen wir eine Menge über eine kleine Anzahl sehr einfacher Proteine, eben weil diese für die Experimente der Biophysiker am besten geeignet waren. Jetzt haben wir all diese wirklich erstaunlichen Technologien, um Zehntausende von Proteinen in einer Probe zu analysieren, aber bislang wurden sie nicht eingesetzt, um Proteinfaltung wirklich umfassend zu untersuchen.“
Warum nicht? Weil man dachte, über die Mechanismen der Proteinfaltung sei alles bekannt? Weil man eben nicht einfach nur umfassendere Daten und schönere Bilder ohne echten Erkenntniszugewinn liefern wollte?
Zum Glück haben Johns-Hopkins-Biochemiker um Stephen Fried, der Obiges sagte, es trotzdem gemacht. Diesen Beitrag weiterlesen »




 Wissenschaftler, die in ihrer Forschung noch klassisch von Hypothesen ausgehen, kennen vielleicht den Namen des mittelalterlichen Philosophen
Wissenschaftler, die in ihrer Forschung noch klassisch von Hypothesen ausgehen, kennen vielleicht den Namen des mittelalterlichen Philosophen