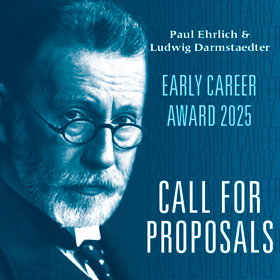Von einem, der auszog, DNA zu messen
von CORNEL MÜLHARDT
Um den Ursprung des Seins zu messen, sollten Sie sich auf die inneren Werte besinnen - jedenfalls bei der PCR.
Viel hilft viel. Fürwahr. Vor allem viel Geld hilft viel. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, wieviel Geld heutzutage den Bach runter geht, nur weil Doktorand A eine Vorliebe für Hersteller X hat? Also deckt A sich mit allen Kits ein, die X so zu bieten hat. Eines Tages tritt dann Doktorand B ins Laborgeschehen ein. B liebt Hersteller Y. Macht nix, es ist ja nicht das Geld, das fehlt, folglich deckt sich B mit Kits von Y ein. Irgendwann beendet A seine Doktorarbeit und verlässt das Labor auf Nimmerwiedersehen, andere Leute folgen. Jetzt schlägt die Stunde von B, dem X schon immer ein Dorn im Auge war. Weil Platz benötigt wird, wandern alle Kits von X, angebrochen oder neu, im Wert von etlichen tausend Mark, in den Müll. Benutzt ja eh kein Mensch mehr. Die Säulchen sind alt (als ob Ionenaustauschersäulen altern könnten). Und anschließend heißt’s, es sei nicht genug Geld für die Forschung da. Nuja.
Üpsilon ist iks
Viel hilft viel“ gilt natürlich auch für die Experimente selbst, die so tagtäglich verbrochen werden, zumindest könnte man diesen Eindruck bekommen, wenn man dem einen oder anderen Bench-Nachbarn über die Schulter guckt. Aber wie jedes Thema kennt auch dieses seine Variationen, dann heißt es Wieviel hilft viel“, Wieviel ist viel?“ oder einfach nur Wieviel?“. Eine nicht triviale Frage, zumindest wenn man PCR betreibt. Immerhin handelt es sich dabei um einen Prozess, bei dem das Ausgangsmaterial exponentiell vermehrt wird. Was aber, wenn man wissen will, wieviel Material man zu Beginn im Tube hatte? Direkt messen geht nicht, dazu ist es zu wenig - logisch, sonst hätte man sich ja die Amplifikation sparen können. Also muss man sich ans Produkt halten. Nichts leichter als das, sagt sich Harry Labortäter, immerhin handelt es sich um eine Gleichung mit nur einer Unbekannten, denn wir kennen die Produktmenge, die Zahl der Zyklen, und wir wissen, dass sich die Produktmenge von Zyklus zu Zyklus verdoppelt. Dieses Problem lässt sich selbst mit den schwachen Mathematikkenntnissen eines Biologen lösen: üpsilon ist iks hoch enn, aufgelöst nach dings, Taschenrechner rausgeholt, wo war nochmal... ups, da ist nur die Quadratwurzel, wie ging das noch, die n-te Wurzel aus y entspricht y hoch was nochmal... Hand aufs Herz, wüssten Sie’s? Nicht? Sagten Sie nicht, Sie hätten Abitur? Egal, wir lassen Harry an dieser Stelle allein mit seinem Ergebnis, es ist sowieso falsch. Der Herrgott, der die PCR ausgeknobelt hat, ist nämlich ein Sadist, weshalb er sie mit gemeinen Fallen gespickt hat. Eine davon ist, dass er seinen Jüngern, die die Lehrbücher schreiben, einflüsterte, die Vermehrungsrate von Zyklus zu Zyklus entspräche einem Faktor zwei. Er unterschlug dabei zwei wichtige Wörtchen: im Idealfall. Sie kennen das Problem aus dem täglichen Leben: Wenn Sie sich den Busen vergrößern lassen, rennen Ihnen die Traummänner die Bude ein, sagt man. Oder: Wenn Sie hart im Labor arbeiten, werden Sie gute Publikationen und die tollsten Jobs bekommen. Im Idealfall.
Doch nicht genug damit, dass der Vermehrungsfaktor eigentlich nie zwei ist, sondern bestenfalls knapp darunter, er ändert sich auch noch permanent während einer PCR, nahezu von Zyklus zu Zyklus. Was sich in den allerersten Zyklen abspielt, ist bislang ein Mysterium, weil man’s nicht messen kann. Zwischen Zyklus 5 und 20 dürften Sie tatsächlich ziemlich nahe am Faktor 2 sein, und danach geht die Geschichte immer mehr gegen 1. Na, glauben Sie immer noch, Sie könnten das mit Ihrem bisschen Schulmathematik lösen?
So viel zum Thema Theoretische Biologie.
Die normative Kraft des Unglaublichen,...
Deshalb haben unsere Altvorderen schnell wieder zur guten alten Verdünnungsreihe gegriffen. Man nehme eine gleiche DNA bekannter Konzentration, stelle davon verschiedene Verdünnungen her und amplifiziere diese parallel zum Versuchsansatz, schon hat man einen geeigneten Standard. Leider scheitert dieses Vorgehen daran, dass der sich ständig ändernde Vermehrungsfaktor eine unglaubliche normative Kraft entwickelt: nach 30 bis 35 Zyklen ist in fast allen Ansätzen gleich viel drin, weil jede Reaktion so lange läuft, bis die Produktmenge ihr Maximum errreicht hat, unabhängig von der Ausgangsmenge. Also begann man, sich neben das PCR-Gerät zu stellen und in regelmäßigen Abständen den Ansätzen kleine Aliquots zu entnehmen, um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen, an dem die DNA-Bande des Versuchsansatzes im Agarosegel gerade so sichtbar wurde, weil nur zu diesem Zeitpunkt ein Vergleich mit den mitlaufenden Standards sinnvoll ist. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie nervig es ist, sein Leben neben einer PCR-Maschine zu verbringen, um alle fünf Zyklen einen 5 µl-Aliquot aus jedem Tube zu entnehmen? Stellen Sie sich jetzt noch vor, Sie hätten 48 oder 96 Ansätze laufen, dann ist der Alptraum perfekt.
der inneren Werte...
Unter anderem wegen dieser praktischen Probleme kam man vom externen Standard schnell wieder ab und begann statt dessen, interne Standards zu verwenden. Intern bedeutet, dass man statt eines Versuchsansatzes derer sechs bis zehn verwendet, wobei jedem Ansatz eine unterschiedliche Menge an Standard-DNA zugegeben wird. Der Standard wird mitamplifiziert und am Ende der PCR sieht man... richtig, hier haben wir ein Problem. Zwar hat die Methode gewaltige Vorteile: Weil Standard und Probe sich einen Tube teilen, sind die Bedingungen für beide Templates garantiert gleich. Beiden gehen in gleichem Maße die Primer und die Nukleotide aus und ein unerwarteter Dreck, der die Amplifikation bremst, wirkt sich auf beide Templates gleichermaßen aus. Man kann daher die Reaktion getrost bis zu ihrem normalen Ende laufen lassen, weil nicht die absolute Menge an Produkt entscheidend ist, sondern das Verhältnis der Produkte von Probe und Standard. Dort, wo das Verhältnis 1:1 ist, war zu Beginn gleich viel Probe wie Standard drin. Nur: Wie unterscheidet man die Amplifikate, die von der Standard-DNA stammen, von denen der Probe? Naja, ein triviales Nachweisproblem. Es reicht, eine Änderung in die Standard-DNA einzufügen, die sich nachweisen lässt. Am einfachsten tut man sich mit einem Größenunterschied, weil man die DNA hinterher sowieso auf ein Gel auftragen wird. Eine Deletion (oder auch Insertion) von 50 bis 200 Basen macht aus einer DNA bereits eine taugliche Standard-DNA, wenngleich Puristen bekritteln, dass ein Längenunterschied von 10-20% bereits eine deutliche Veränderung der Amplifikationshäufigkeit mit sich bringen kann. Das kann ich bestätigen, weil ich einst anderthalb Jahre lang vergeblich versuchte, ein 1,5 kb-Fragment reproduzierbar zu amplifizieren, bis sich herausstellte, dass das Fragment einen Abschnitt von ca. 200 bp Länge enthielt, der die Amplifikationseffizienz auf nahezu Null reduzierte. Aber das sind Ausnahmen. Normalerweise sollte so eine kleine Änderung keinen Einfluss auf die Vergleichbarkeit haben. Eleganter ist es allerdings, nur eine Punktmutation einzuführen, die eine neue Restriktionsschnittstelle schafft - oder gegebenenfalls eine alte entfernt. Vor der Elektrophorese muss dann noch geschnitten werden, und zwar vollständig (!), weil die Quantifizierung sonst falsch ausfällt.
Ein Problem allerdings bleibt: Für jede DNA, die quantifiziert werden soll, muss eine eigene Standard-DNA hergestellt werden. Das ist lästig angesichts der Tatsache, dass so eine Klonierung auch unter günstigen Umständen eine ganze Arbeitswoche in Anspruch nimmt. Schlimmer noch: Es macht unflexibel. Schlecht für den typischen Forscher, der morgens mit einem brillanten Gedanken aufwacht, welcher bis zum Abend umgesetzt sein muss, um auch dem brillanten Gedanken des Folgetages eine Chance zu geben.
und des Gebets
Doch wo Brillanz ist, ist auch Geld. Und das Geld erkannte die Bedürfnisse des Forschers, und gebar die Real Time Quantitative PCR. Demnächst in diesem Kino.
Letzte Änderungen: 08.09.2004