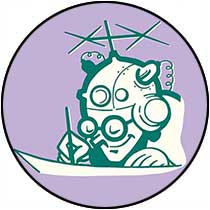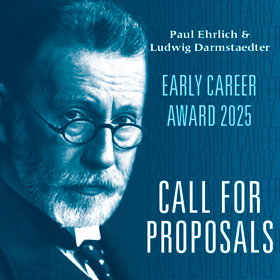Faktorfischen
Archiv: Schöne Biologie
Ralf Neumann
Früher wimmelte es in der Bioforschung nur so von Faktoren. Dies, weil vielfach nach folgendem Prinzip experimentiert wurde: Man stellte Extrakte von irgendetwas her, gab sie zu Zellen, Geweben oder Organismen – und die machten plötzlich etwas, das sie ohne Extrakt nicht tun. Ergo: In dem kruden Extrakt verbirgt sich ein Faktor (seltener auch mal zwei oder mehr), der den beobachteten Effekt anschiebt. Und dann ging in aller Regel die lange und aufwändige Faktor-Reinigung los...
Beispiele? Das erste Hormon wurde so gefunden. 1902 beobachteten William Bayliss und Ernest Starling, dass ein wenig Salzsäure-behandelte Schleimhaut aus dem Zwölffingerdarm eines Hundes die Säfte der Bauchspeicheldrüse zum Fließen bringt. Den „Schleimhaut-Faktor“ nannten sie Sekretin und führten allgemein den Begriff „Hormon” für diese Art Signalmolekül ein. (Das erste rein dargestellte Hormon wurde dann allerdings das Adrenalin.)
Oder Weidenrindenextrakt. Griechen, Römer, Germanen – von allen ist überliefert, dass sie den Saft gekochter Weidenrinde gegen Schmerzen und Fieber einnahmen. 1828 isolierte Johann Buchner schließlich den „lindernden Faktor” aus Weidenrinden-Extrakt und identifizierte ihn als Salicin. Dieses setzt allerdings erst der Körper zur tatsächlich wirksamen Salicylsäure um – bekanntlich die Vorlage zur nachfolgenden chemischen Entwicklung von Acetylsalicylsäure alias Aspirin.
Parallel gab es zwar irgendwann auch den alternativen Ansatz, wonach Forscher nicht mehr effektive Extrakte nach Faktoren durchwühlten, sondern sich vielmehr von fehlenden Effekten (etwa durch Mutation) zu den gleichsam fehlenden oder defekten Faktoren herunterzuarbeiten versuchten. Richtig in den Hintergrund gedrängt wurde diese Art „Vom-Extrakt-zum-Faktor”-Forschung allerdings erst während des Siegeszuges der Molekularbiologie und ihrer sogenannten reversen Methoden. Damit waren plötzlich jede Menge genetischer Faktoren, also Gene, handhabbar geworden, ohne dass man die von ihnen (mit)verantworteten Effekte kannte. Also schaltete man die Faktoren einfach aus und beobachtete, welche Effekte oder Strukturen dadurch schlichtweg ausblieben. Das ging mit grober Mutagenisierung samt Phänotyp-Screening los – und setzt sich bis heute mit Knockout, Knockdown, CRISPR und Co. immer feiner fort.
Es gibt sie aber noch – die gute, alte Faktorsuche in Extrakten. Vielleicht, weil man an gewisse Phänomene einfach nicht anders herankommt. Ein nettes Beispiel dafür beschrieben kürzlich südafrikanische Evolutionsbiologen in Biology Letters (Vol. 10(2): 20131088) mit Chlamydomonas. Sterben die einzelligen Algen unvorbereitet, bekommen auch ihre Nachbarn Probleme: aus den Zell-Leichen strömen Substanzen aus, die toxisch auf die bis dahin Überlebenden wirken. Ganz anders aber, wenn die Zellen kontrolliert programmierten Selbstmord begehen – zum Beispiel als Antwort auf Hitzestress. Die Südafrikaner sammelten sowohl Wasser, in denen „Chlamys” plötzlich durch Ultraschall gestorben waren, wie auch welches, in denen andere gerade kontrollierten Selbstmord begangen hatten. Beides gaben sie nachfolgend jeweils zu unbehelligten Artgenossen dazu. Und siehe da, die „Faktor-Signatur” der Selbstmörder ließ die Chlamys deutlich schneller wachsen – ja, sie hemmte sogar zugleich das Wachstum anderer Algen signifikant.
Wahrscheinlich sind die Südafrikaner schon dabei, diese „Selbstmord-zum-Wohle-der-gesamten-Spezies”-Faktoren aus dem Algenwasser zu putzen.
Letzte Änderungen: 07.04.2014