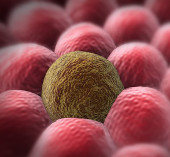Trittbrettfahrer im Tumor
(31.1.2015) Tumore brauchen Wachstumsfaktoren. Basler Forscher haben jetzt untersucht, wieso sich manche Krebszellen um die Produktion dieses "Gemeinschaftsguts" drücken können.
In vielzelligen Organismen herrscht zivilisierte Arbeitsteilung. Die Keimzellen bekommen die Chance, zur nächsten Generation beizutragen, während sich die Körperzellen kontrolliert vermehren und Spezialisten für bestimmte Aufgaben des Körpers werden. Entsteht jedoch ein Tumor, bricht die Anarchie aus. Innerhalb des Tumors gilt wieder das Recht des Stärkeren. Diejenigen Krebszellen, die sich am schnellsten vermehren, setzen sich durch und verdrängen alle anderen, möchte man meinen.
Aber so einfach ist es nicht.
Denn die Zellpopulation innerhalb eines Tumors kann erstaunlich heterogen sein, wie z.B. genomische Studien individueller Krebszellen gezeigt hatten. Ein Tumor ist in der Regel keine klonale Zellmasse aus quasi identischen Zellen, sondern ein Gefüge aus Mitspielern mit verschiedenen Genotypen und auch verschiedenen Eigenschaften. Wie wird diese heterogene Gemeinschaft erhalten? Wieso verdrängt nicht ein Zelltyp die anderen? Mikrobiologen und Ökologen haben ganz ähnliche Fragen in ihren Gebieten schon früher untersucht als Krebsforscher, und ihre Forschungsansätze könnten jetzt dabei helfen, die Heterogenität der Tumorzellen zu verstehen.
Durchfüttern auf Kosten der Nachbarn
Denn wie in einer Mikrobengemeinschaft gibt es auch im Tumor beispielsweise Kooperationen zwischen Zellen mit komplementären Eigenschaften – ein faires Geben und Nehmen. Aber es eröffnen sich auch Chancen für Betrüger („Cheater“), die sich auf Kosten der Umgebung durchfüttern. Wie sich Szenarien entwickeln, in denen alle von den Gütern profitieren, die einzelne Mitglieder der Gemeinschaft bereitstellen – das studieren Spieltheoretiker aus Evolutionsbiologie und Ökonomie unter dem Fachterminus „Public Good Dynamics“. Kann man deren Erklärungs-Ansätze auch auf die Tumorbiologie übertragen?
Marco Archetti (Norwich, Großbritannien) und Daniela Ferraro sowie Gerhard Christofori (beide Universität Basel) haben das jetzt versucht, experimentell und in Simulationen (PNAS, doi: 10.1073/pnas.1414653112). Das „Public Good“ in ihren Experimenten ist der Wachstumsfaktor IGF-II. Die Forscher schickten zwei Sub-Zelltypen von Mäuse-Krebszellen aus der Bauchspeicheldrüse in einen Wettbewerb. Zum einen Zellen, die IGF-II produzieren und ins extrazelluläre Medium abgeben (IGF-II +/+), und zum anderen Zellen, die dazu nicht mehr in der Lage sind (IGF-II -/- ).
Tragedy of the commons
In Einzelkultur und unter Standard-Bedingungen gehen die IGF-II -/- Zellen ein. Aber in Ko-Kultur mit den IGF-II-Produzenten haben sie eine Chance zu überleben, denn der Wachstumsfaktor wird extrazellulär ausgeschüttet und die Nicht-Produzenten können von der Produktionsleistung ihrer Nachbarn profitieren – auf Kosten der Gesamtpopulation, die dann insgesamt weniger IGF-II zur Verfügung hat. Es droht also das Trittbrettfahrer-Syndrom („Tragedy of the commons“). Wer sich den Aufwand spart, zum Gemeinschaftsgut beizutragen, kann sich schneller vermehren. Aber je mehr die Trittbrettfahrer Überhand nehmen, desto mehr schmilzt das Gemeinschaftsgut dahin, und die Existenz der gesamten Zell-Population ist bedroht.
Was also passiert, wenn man IGF-II-Produzenten und Cheater gemeinsam kultiviert? Kommt drauf an. Wie die Autoren der PNAS-Studie herausfanden, hängt das Ergebnis insbesondere von der Serum-Konzentration des Kulturmediums ab, in dem die Zellen heranwachsen.
Unter „normalen“ Kulturbedingungen mit 10 % fetalem Kälberserum (FBS) verlieren die IGF-II-produzierenden Zellen das Rennen – die Trittbrettfahrer haben einen Pyrrhus-Sieg errungen. Zellen, die sich den Aufwand der IGF-II-Produktion sparen, haben unter diesen experimentellen Bedingungen zwar einen selektiven Vorteil. Aber ohne die +/+ - Zellen hat die Population keine Zukunft.
Bei sehr niedriger FBS-Konzentration wiederum gewinnen die IGF-II-Produzenten. Auch das ist intuitiv verständlich: Der Wachstumsfaktor wird zwar extrazellulär ausgeschüttet. Aber wenn es ganz hart kommt, hat der Produzent selbst am ehesten Chancen, eine genügende Menge der Ressource abzubekommen.
Interessant ist vor allem das Ergebnis bei „intermediärer“ FBS-Konzentration, denn hier fanden die Forscher ein Gleichgewicht, also eine stabile Koexistenz der beiden Zelltypen.
Trittbrettfahrer werden geduldet
Verstehen kann man dieses Ergebnis mit der evolutionären Spieltheorie. Spieltheoretiker modellieren, welche Fitness-Kosten und welche Vorteile die Konsumenten und Produzenten des „Public Good“ jeweils haben, abhängig von Häufigkeit und Verhalten der anderen Mitspieler.
Wie beispielsweise bei bakteriellen Cheater-Experimenten vielfach gezeigt, können Populationen einen gewissen Anteil Trittbrettfahrer mitschleppen. Das Stichwort dabei ist die „negativ frequenzabhängige Selektion“. Einfach gesagt: Fitness-Nachteile für die Cheater entstehen erst dann, wenn sie sich zu sehr vermehren.
Die PNAS-Autoren simulierten das Zusammenspiel der beiden Zelltypen mit sogenannten Voronoi-Graphen, einer Art planarem Netzwerk aus virtuellen Zellen. Sie konnten dabei zeigen, dass es für das Endresultat verschiedener „Wettkampfszenarien“ zwischen den beiden Zelltypen wesentlich auf das jeweilige Verhältnis von Kosten zu Nutzen der IGF-II-Produzenten ankommt. Trittbrettfahrer können sich stabil in einer Population halten, ohne ihren Untergang auszulösen, wenn es zumindest einen kleinen Extra-Nutzen für IGF-II-Produzenten gibt.
Dass Konzepte aus der Ökologie und der evolutionären Spieltheorie relevant sind, um das Innenleben von Tumoren zu verstehen, hätte man vor gar nicht so langer Zeit kaum im Sinn gehabt. Eine schöne Bestätigung, dass man in der Wissenschaft nicht vorhersehen kann, wozu man Erkenntnisse später einmal brauchen kann.
Hans Zauner
Illustration: © ugreen - Fotolia.com