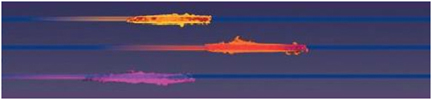Arrgh, unser Mail-Postfach quillt gerade über vor lauter Erfolgsmeldungen der einzelnen Universitäten, dass sie im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder irgendwie „gewonnen haben“.
 Wundern tut uns das allerdings nicht. Schließlich hat gerade ein Entscheidungsgremium aus Wissenschaft und Politik zum Ende eines wahren Wettbewerb-Marathons verkündet, ganze 57 sogenannte Exzellenzcluster an insgesamt 34 deutschen Universitäten zu fördern. (Für die gesamte Förderlinie stehen ab Januar 2019 sieben Jahre lang jeweils 385 Millionen Euro Steuergelder zur Verfügung, macht also im Schnitt rund 47 Millionen Euro pro Cluster — wobei die Unterschiede im einzelnen recht groß sind, beispielsweise zwischen Geräte-intensiven und „Geräte-freien“ Disziplinen. Im Detail kann man die Liste der „Sieger“ hier studieren.)
Wundern tut uns das allerdings nicht. Schließlich hat gerade ein Entscheidungsgremium aus Wissenschaft und Politik zum Ende eines wahren Wettbewerb-Marathons verkündet, ganze 57 sogenannte Exzellenzcluster an insgesamt 34 deutschen Universitäten zu fördern. (Für die gesamte Förderlinie stehen ab Januar 2019 sieben Jahre lang jeweils 385 Millionen Euro Steuergelder zur Verfügung, macht also im Schnitt rund 47 Millionen Euro pro Cluster — wobei die Unterschiede im einzelnen recht groß sind, beispielsweise zwischen Geräte-intensiven und „Geräte-freien“ Disziplinen. Im Detail kann man die Liste der „Sieger“ hier studieren.)
Nun ist das insgesamt eine derartige Masse an „exzellenten“ Projekten, dass man sich unwillkürlich fragen muss, ob es denn auch noch „normale“ Forschung gibt in Deutschland. Und schon merken wir: „Exzellenz“ ist relativ. Ein Begriff, den man nahezu beliebig mit Inhalt füllen kann — so, wie man es gerade braucht. Entsprechend kommentierte etwa die Bremer Wissenschaftssenatorin und stellvertretende Vorsitzende der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) Eva Quante-Brandt das Ergebnis mit: „Die Spitze liegt in der Breite“. Aha…!? Und Bundeswissenschaftsministerin Anja Karliczek ergänzte: „Wir haben Exzellenz an vielen deutschen Hochschulen. Das ist die Stärke und die internationale Attraktivität unseres Systems.“
Hm? Sollte „Exzellenz“ per definitionem nicht immer und ausschließlich die absolute Spitze einer Pyramide darstellen? Und wird so gesehen „Exzellenz“ nicht eher abgewertet, wenn sie immer mehr in die Breite geht? Wird auf diese Weise nicht heute exzellent, was es gestern noch nicht war — schlichtweg durch Evaluation und Wettbewerbs-Sieg?
Wie gesagt, Exzellenz ist immer relativ. Es ist noch gar nicht lange her, da galt beispielsweise vielen das gesamte wissenschaftliche Tun per se als exzellent. Klar, wenn man es mit reiner Fabrik- oder Verwaltungsarbeit verglich. Wenn die Wissenschaft jedoch als Bezugsgröße nur bei sich selber bleibt, dann zitieren wir hier hierzu gerne nochmals den folgenden Absatz aus dem letztjährigen Laborjournal-Essay des alten Konstanzer Wissenschaftstheoretikers Jürgen Mittelstraß:
Damit Exzellenz wirklich werden kann, muss viel Qualität gegeben sein; und damit Qualität wirklich werden kann, muss viel Mittelmaß gegeben sein. Allein Exzellenz und nichts anderes zu wollen, wäre nicht nur wirklichkeitsfremd, sondern für die Entstehungsbedingungen von Exzellenz vermutlich fatal — sie verlöre die wissenschaftliche Artenvielfalt, aus der sie wächst. Und darum eben auch: Nicht nur Erbarmen mit Durchschnittlichkeit und Mittelmaß, sondern zufriedene Unzufriedenheit mit diesen. Es ist das breite Mittelmaß, das auch in der Wissenschaft das Gewohnte ist, und es ist die breite Qualität, die aus dem Mittelmaß wächst, die uns in der Wissenschaft am Ende auch die Exzellenz beschert — mit oder ohne angestrengte Evaluierung.
Was gleichsam bedeutet, dass man Exzellenz nicht durch Wettbewerbe „erzwingen“ kann. Wohl aber herbeireden.
Doch das ist wieder ein anderes Thema, das unter anderem der Schweizer Ökonom Martin Binswanger vor zwei Jahren ebenfalls in einem Laborjournal-Essay sezierte…
Ralf Neumann
Illustr.: iStock / Akindo
x

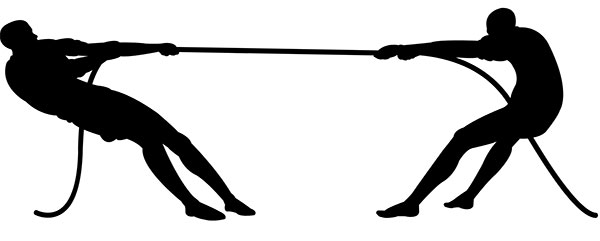 Aber ob das alleine reichen würde? Beispielsweise würde so gar nicht dazu passen, was neulich ein Forscher uns gegenüber am Telefon proklamierte: „Wissen Sie, ich bin ein überzeugter Anhänger des olympischen Gedankens!“ Damit meinte er natürlich nicht „Dabeisein ist alles!“ Nein, „Citius, altius, fortius“ — „Schneller, höher, stärker“ — gab Pierre de Coubertin seinerzeit als Motto der Olympischen Bewegung aus. Und genau so wollte der Anrufer seinen Satz auch verstanden haben: Knallharter Wettbewerb mit klaren Siegern und Verlierern.
Aber ob das alleine reichen würde? Beispielsweise würde so gar nicht dazu passen, was neulich ein Forscher uns gegenüber am Telefon proklamierte: „Wissen Sie, ich bin ein überzeugter Anhänger des olympischen Gedankens!“ Damit meinte er natürlich nicht „Dabeisein ist alles!“ Nein, „Citius, altius, fortius“ — „Schneller, höher, stärker“ — gab Pierre de Coubertin seinerzeit als Motto der Olympischen Bewegung aus. Und genau so wollte der Anrufer seinen Satz auch verstanden haben: Knallharter Wettbewerb mit klaren Siegern und Verlierern. Wer seine Intelligenz dazu nutzen will, viel Geld zu verdienen, geht überall hin — nur nicht in die Wissenschaft. Das ist Fakt. Und so geht dem Geschäft, in dem eigentlich die schlauesten Köpfe wirken sollen, schon mal viel „Hirn“ verloren.
Wer seine Intelligenz dazu nutzen will, viel Geld zu verdienen, geht überall hin — nur nicht in die Wissenschaft. Das ist Fakt. Und so geht dem Geschäft, in dem eigentlich die schlauesten Köpfe wirken sollen, schon mal viel „Hirn“ verloren. 2001 gewann völlig überraschend Goran Ivanisevic im englischen Wimbledon das wichtigste Tennisturnier der Welt. Eigentlich war er damals schon lange abgeschrieben. Zwar hatte er zuvor in den Jahren 1992, 1994 und 1998 dreimal das Wimbledon-Finale verloren — danach jedoch verschwand er ziemlich in der Versenkung, lieferte nahezu keine Ergebnisse mehr. Für Wimbledon 2001 war er daher natürlich nicht qualifiziert, dennoch ließen die Wimbledon-Veranstalter Ivanisevic in einem Akt nostalgischer Gnade mit einer Wildcard an dem Turnier teilnehmen. Der Rest ist Tennis-Geschichte…
2001 gewann völlig überraschend Goran Ivanisevic im englischen Wimbledon das wichtigste Tennisturnier der Welt. Eigentlich war er damals schon lange abgeschrieben. Zwar hatte er zuvor in den Jahren 1992, 1994 und 1998 dreimal das Wimbledon-Finale verloren — danach jedoch verschwand er ziemlich in der Versenkung, lieferte nahezu keine Ergebnisse mehr. Für Wimbledon 2001 war er daher natürlich nicht qualifiziert, dennoch ließen die Wimbledon-Veranstalter Ivanisevic in einem Akt nostalgischer Gnade mit einer Wildcard an dem Turnier teilnehmen. Der Rest ist Tennis-Geschichte…