 Es soll ja vorkommen, dass hin und wieder ein eingefleischter Biochemiker im Vortrag eines dezidierten Genetikers sitzt. Oft genug sitzt er dann da, hört zu, denkt mit — und wartet vergeblich auf den Clou.
Es soll ja vorkommen, dass hin und wieder ein eingefleischter Biochemiker im Vortrag eines dezidierten Genetikers sitzt. Oft genug sitzt er dann da, hört zu, denkt mit — und wartet vergeblich auf den Clou.
So trug etwa kürzlich ein Genetiker vor, wie er in Fliegen mit auffälligen Verhaltensstörungen eine Chromosomenregion kartiert hatte, in dem offenbar ein Gen liegt, dessen Ausfall den Defekt direkt mitverantwortet. Fünfzehn Vortragsminuten später hatte er das Gen identifiziert, fünf Minuten darauf hatte er es sequenziert — und in den restlichen zehn Minuten beschrieb er, wie er durch gezielte Mutationen in eben jenem Gen verschieden starke Ausprägungen der Verhaltensstörung induzieren konnte — und wie er die „schlimmsten“ Verhaltensmutanten durch Einbringen des „gesunden“ Gens retten konnte. Klar, dass am Ende des Vortrags der Genetiker sein Publikum glücklich und zufrieden ob dieser runden Story anstrahlte.
Dann meldete sich der Biochemiker und fragte: „Okay, Sie wissen jetzt, dass das Gen für das gesunde Verhalten notwendig ist. Aber wie steuert nun das Genprodukt das Verhalten? Was tut es in der Zelle? Wo und wie entfaltet es welche Funktion? Welcher Mechanismus steckt dahinter?“ Der Genetiker hob die Schultern, raunte leise, dass er dazu keine Hinweise habe — und grinste nunmehr leicht blöde weiter ins Publikum.
Da waren sie also wieder mal aufeinander geprallt — die beiden Welten der Genetik und der Biochemie. Und der konzeptionelle Kernunterschied zwischen beiden wurde erneut mehr als deutlich: Der grundlegende Ansatz des Genetikers ist zu studieren, wie ein System variiert oder ausfällt, wenn einzelne Komponenten gestört oder defekt sind — um dann daraus zu schließen, welche Komponenten bei welchen Prozessen mitspielen. Im Gegensatz dazu versucht der Biochemiker zu entschlüsseln, wie die Komponenten eines Systems zusammengehören und wie die daraus resultierenden Interaktionen die Funktion des Systems bewerkstelligen.
Beides komplementäre experimentelle Ansätze, um komplexe Systeme zu entschlüsseln. Und natürlich umso effektiver, je besser man sich versteht.
(Foto: pholidito / Fotolia)

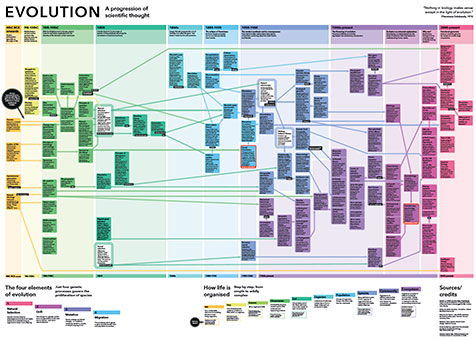
 Was machbar ist, wird in der Regel auch gemacht. Vor allem wenn einem als Forscher, der ja immer etwas am Laufen haben muss, gerade nichts Originelles einfallen will, ist die Verlockung besonders stark. Nur allzu gerne folgt er dann diesem Imperativ der reinen Machbarkeit. Es hat ja auch Vorteile: Man braucht kaum komplizierte Konzepte, ein oftmals recht plakativer Zweck reicht meist schon aus. Und man kann es leicht verkaufen. Denn was machbar ist, bietet eine gewisse Ergebnisgarantie. Wenn ich ein Genom sequenziere, habe ich am Ende eine Sequenz — und das ist doch schon mal was. Welche Erkenntnisse mir die Sequenz bringt — nun, das kann man dann noch sehen. Sehr beliebt unter diesen konzeptionsarmen „Just do it, think later“-Ansätzen sind auch sogenannte „Fishing Expeditions“. Etwa einfach mal ein Genexpressionsmuster aufnehmen — geht ja leicht heutzutage –, Konzepte entwickeln sich dann (hoffentlich) mit den Daten. Oder auch nicht. Vor kurzem wurde dieses Thema in einem Weblog im Zusammenhang mit der Schlafforschung diskutiert. Ein wenig erfolgreiches Feld, wie die Teilnehmer meinten. Immer noch weiß man nicht, was Schlaf eigentlich ist und warum er sich evolutionsgeschichtlich entwickelt hat. Und weil einem vor lauter Konzeptionsleere nichts mehr einfiel, begann man „nach Schlafgenen zu fischen“. Die lächerliche Beute? Die üblichen allgegenwärtigen Verdächtigen in Hirnzellen: Proteinkinasen, Dopaminrezeptoren, Serotonintransporter, und so weiter. Einer der Blogger fuhr daraufhin aus der Haut: „Verstehen die nicht, dass Schlaf eine emergente Eigenschaft des multizellulären Gehirns ist? Nicht einzelne Neuronen schlafen (oder sind wach) — die Gehirne tun das. Der „Schlafmechanismus“ ist kein molekularer Mechanismus, sondern das Ergebnis eines speziellen Musters neuronaler Aktivität und Konnektivität.“ Gutes Beispiel, dass ein wenig konzeptionelles Denken sich durchaus lohnen kann, bevor man einfach macht, was eben geht.
Was machbar ist, wird in der Regel auch gemacht. Vor allem wenn einem als Forscher, der ja immer etwas am Laufen haben muss, gerade nichts Originelles einfallen will, ist die Verlockung besonders stark. Nur allzu gerne folgt er dann diesem Imperativ der reinen Machbarkeit. Es hat ja auch Vorteile: Man braucht kaum komplizierte Konzepte, ein oftmals recht plakativer Zweck reicht meist schon aus. Und man kann es leicht verkaufen. Denn was machbar ist, bietet eine gewisse Ergebnisgarantie. Wenn ich ein Genom sequenziere, habe ich am Ende eine Sequenz — und das ist doch schon mal was. Welche Erkenntnisse mir die Sequenz bringt — nun, das kann man dann noch sehen. Sehr beliebt unter diesen konzeptionsarmen „Just do it, think later“-Ansätzen sind auch sogenannte „Fishing Expeditions“. Etwa einfach mal ein Genexpressionsmuster aufnehmen — geht ja leicht heutzutage –, Konzepte entwickeln sich dann (hoffentlich) mit den Daten. Oder auch nicht. Vor kurzem wurde dieses Thema in einem Weblog im Zusammenhang mit der Schlafforschung diskutiert. Ein wenig erfolgreiches Feld, wie die Teilnehmer meinten. Immer noch weiß man nicht, was Schlaf eigentlich ist und warum er sich evolutionsgeschichtlich entwickelt hat. Und weil einem vor lauter Konzeptionsleere nichts mehr einfiel, begann man „nach Schlafgenen zu fischen“. Die lächerliche Beute? Die üblichen allgegenwärtigen Verdächtigen in Hirnzellen: Proteinkinasen, Dopaminrezeptoren, Serotonintransporter, und so weiter. Einer der Blogger fuhr daraufhin aus der Haut: „Verstehen die nicht, dass Schlaf eine emergente Eigenschaft des multizellulären Gehirns ist? Nicht einzelne Neuronen schlafen (oder sind wach) — die Gehirne tun das. Der „Schlafmechanismus“ ist kein molekularer Mechanismus, sondern das Ergebnis eines speziellen Musters neuronaler Aktivität und Konnektivität.“ Gutes Beispiel, dass ein wenig konzeptionelles Denken sich durchaus lohnen kann, bevor man einfach macht, was eben geht.



